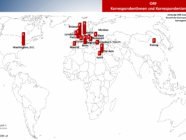Erstveröffentlichung: Neue Zürcher Zeitung vom 3. August 2010
 Die digitalen Kommunikationstechniken zerstören die alte Medienordnung. Sie unterspülen die wirtschaftliche Basis des klassischen Journalismus.
Die digitalen Kommunikationstechniken zerstören die alte Medienordnung. Sie unterspülen die wirtschaftliche Basis des klassischen Journalismus.
Um zu ermessen, was in den USA derzeit passiert, hilft vielleicht ein Gedankenexperiment: Man übertrage die jüngsten Entwicklungen, so gut es geht, auf die Schweiz. Die Tamedia hätte sich dann mit der Übernahme von Edipresse überlupft und befände sich im Insolvenzverfahren – wie die Tribune Co. in Chicago, die mit dem Kauf von «Times Mirror» sowie «Los Angeles Times» und «Newsday» die Vision eines Zeitungsimperiums verband, das die wichtigsten US-Märkte vom Osten bis zum Westen umspannen sollte. Seit vier, fünf Jahren hätten in der Schweiz außerdem die Tageszeitungen bis zu einem Drittel ihrer Auflage verloren, aber auch bei den privaten Fernsehanbietern ringsum wären die Quoten im freien Fall. Die meisten Redaktionen wären nur noch halb so groß wie vor ein paar Jahren – Torsi ihrer selbst.
Wenn Rupert Murdoch…
Es wäre damit zu rechnen, dass Hochburgen des Schweizer Bildungsbürgertums, sagen wir Basel und Genf, noch in diesem Jahr ohne eigene Qualitätszeitungen auskommen müssten – so wie das für Boston und San Francisco 2009 bereits ernsthaft zu befürchten war. Ringier hätte zudem das Wirtschaftsblatt «Cash» nicht eingestellt und den «Blick» nicht neu positioniert, sondern beide an Rupert Murdoch verkauft.
Der Tycoon würde mit einem Gewaltakt beide Blätter zu Wettbewerbern trimmen, welche die NZZ von allen Seiten angreifen. Die NZZ wäre zudem nur noch dank der Finanzspritze eines zwielichtigen mexikanischen Multimillionärs am Leben. Statt sich um ihre zahlenden Kernleser zu kümmern, würde sie außerdem ähnlich der «New York Times» auf dem Boulevard herumtingeln und verzweifelt all ihre Anstrengungen darauf richten, im Internet so viele Hits wie möglich zu generieren, also neue, ganz andere Publika zu erschließen.
So weit das Szenario. Wie es SF 1 und SF 2 erginge, wissen wir nicht. Denn für den Service public gibt es in den USA kein auch nur halbwegs vergleichbares Äquivalent. Als Kronzeuge kann indes Heiner Hug einspringen: In seinem jüngsten Buch «Fernsehen ohne Zuschauer» wird die «Tagesschau» von deren früherem Chef als der «größte Seniorenklub des Landes» bezeichnet. Das Durchschnittsalter ihrer Zuschauer liegt heute bei 59,2 Jahren.
All dies wirft Fragen nach der Überlebensfähigkeit von Qualitätsjournalismus auf – aber auch nach dem künftigen Beitrag des Service public zu unser aller Versorgung mit Nachrichten. Was sollen und können öffentlichrechtliche Medien unter den radikal veränderten Bedingungen «im öffentlichen Interesse» leisten? Ist das, was sie gegen hohe Gebührengelder bisher fürs Gemeinwesen erbracht haben, aufs Internet übertragbar? Solche Fragen sind nur schwer zu beantworten. Aber es ist womöglich bereits fünf vor zwölf, um sie zu stellen und öffentlich über sie zu diskutieren.
Antworten setzen zum einen so etwas wie einen Konsens darüber voraus, worin das öffentliche Interesse besteht. Im herkömmlichen Mediensystem hatten wir in der Presse und beim (deutschen) privaten Rundfunk Aussenpluralismus, also eine Vielzahl unterschiedlich positionierter Redaktionen. Weil solche Vielfalt angesichts begrenzter Frequenzen im Äther nicht möglich war, sollte das öffentlichrechtliche Konstruktionsprinzip bei Radio und Fernsehen zumindest Binnenpluralismus, sprich: eine Vielfalt politischer Positionen innerhalb eines Hauses, garantieren. Im Internet gibt es solche Engpässe nicht mehr – im Prinzip ist dort jeder sein eigener Verleger.
Der Service public war indes stets auch als Korrektiv von Marktmacht gedacht – er sollte allzu mächtige Verleger oder private Rundfunkveranstalter in die Schranken verweisen. Eine wachsende Zahl privater Medienunternehmen hat von sich aus Binnenpluralismus institutionalisiert: Vor allem die Großen der Branche verlegten sich in der Schweiz und in Deutschland aufs Geldverdienen, und das gelingt besser, wenn sich Printmedien oder Sender zwar innerhalb des Mainstreams positionieren, aber dabei politisch nicht allzu sehr festlegen. Das System, das sich in der jetzigen Arbeitsteilung erst Mitte der achtziger Jahre herausbildete, war nicht frei von Interessenkonflikten, aber es ruhte halbwegs stabil auf seinen zwei Säulen.
Zurzeit erleben wir, dass infolge einer technologischen Revolution beide klassischen Pfeiler wegbrechen. Sie haben in ihrer bisherigen Ausprägung keine Zukunft, denn die nachwachsende Generation abonniert oder kauft weder gedruckte Zeitungen, noch sieht sie fern. Die jungen Leute wandern vielmehr scharenweise ins Internet ab. Dort konvergieren die bisherigen Medien.
Clash der Kulturen
Das Wort Konvergenz ist allerdings ein Euphemismus – es geht nicht um ein Sich-Annähern oder Zusammenkommen und auch nicht um eine friedliche Koexistenz der alten Medien im weltweiten Web. Vielmehr prallen die bisherigen Systeme mit großer Wucht aufeinander. Außerdem stoßen sie auf eine nie gekannte Vielzahl neuer Anbieter im Netz: Da sind die wendigen kleinen Schnellboote, die Blogs, die «Medienimperien in der Jackentasche», von denen in einem Internet-Manifest die Rede war.
Aber es gibt auch längst neue Großtanker wie Google, Yahoo und Microsoft. Einige Betreiber von Suchmaschinen und Social Networks sind inzwischen die Oligopolisten, deren Marktmacht es in Zukunft einzudämmen gälte, womöglich auch durch neue Formen des Service public. Obendrein stehen einem die Haare zu Berge, wie mit Privatsphäre und Copyright umgegangen wird. Doch gab es bisher keinen kollektiven Aufschrei – nur kurzsichtig-naive Freude, dass alles gratis zu haben ist, wofür man früher bezahlen musste. – Die Wucht des Zusammenpralls der alten und der neuen Anbieter im Internet und seine Wirkungen können wir offenbar noch nicht so richtig ermessen. In Europa befinden wir uns derzeit kurz vor dem Aufschlag. Die wenigen, die ihn realistisch auf sich zukommen sehen, scheinen in einer Art Schockstarre zu verharren. Seitdem die Bilder im Web 2.0 laufen lernten, hat in Amerika CNN die «New York Times» von ihrer Spitzenposition unter den Online-Nachrichtenanbietern verdrängt. Aber anders als SF, ARD, ZDF und BBC finanziert sich CNN nicht durch Gebührengelder und verzerrt somit nicht den Wettbewerb.
Die Frage, was Medien im öffentlichen Interesse leisten können und sollen, ist jedenfalls mehr denn je auf das Internet zu beziehen. Was wiederum Redaktionen dort leisten können und sollen, hängt von ihrer Finanzierung ab – und da türmen sich die Probleme auf, die es abzuarbeiten gälte.
Lausige Pfennige im Internet
Sinkende Druckauflagen und die Gratiskultur, die sich nicht nur im Internet breitmachte, lassen erwarten, dass nur noch öffentlich finanzierte Anbieter von Qualitätsjournalismus über gesicherte Einkünfte verfügen. Sie verschaffen dem öffentlichen Rundfunk einen Wettbewerbsvorteil, den Häuser, die ihre Angebote aus Werbung finanzieren müssen, nicht einholen können.
Wir wissen inzwischen, dass die Werbung zwar mit den Publika ins Internet wandert, aber keineswegs zwingend dorthin, wo journalistische Angebote zu finanzieren wären. «You get only lousy Pennies in the Web» – wir sollten den verzweifelten Ruf des Verlegers Hubert Burda ernst nehmen. Denn von der Online-Werbung profitieren bis jetzt vor allem Suchmaschinen und Social Networks, Redaktionen sind mit ihr kaum bezahlbar.
Auch der Anteil der Werbeeinnahmen, der einst aus Kleinanzeigen stammte, bricht den Verlagen ersatzlos weg. In Amerika waren das im Jahr 2000 noch 20 Milliarden Dollar, sprich: 40 Prozent ihrer Werbeeinkünfte. Kleinanzeigen gibt es inzwischen online bei Craigslist und Kjiji gratis – übrigens nicht nur in den USA, sondern auch in der Schweiz. Da hat sich das nur noch nicht hinreichend herumgesprochen.
Die Gratiskultur ist eine Kultur des Trittbrettfahrens: Redaktionen glauben, ohne Agenturleistungen auszukommen, Journalisten schreiben immer hemmungsloser voneinander ab. Public Relations, die den Redaktionen ebenfalls «gratis» bereitgestellt werden, subventionieren den Journalismus nicht nur in nie gekanntem Ausmaß, sie pervertieren ihn auch und berauben ihn seiner Glaubwürdigkeit. Es lohnt sich nicht mehr für Redaktionen, in «Scoops» zu investieren: Im 24/7-Nachrichtenzyklus profitiert von investigativer Rechercheleistung in erster Linie die Konkurrenz. Sie kann dieselbe Nachricht Sekunden später verbreiten, ohne die zugehörige journalistische Vorarbeit finanziert zu haben. «Copy paste» triumphiert.
Journalismus, wie wir ihn (noch) kennen, droht unter diesen Bedingungen im Bermudadreieck zu verschwinden. Und sollte er nur noch auf einer einsamen öffentlichrechtlichen Insel stattfinden, so wäre uns vermutlich auch bei diesem Gedanken ziemlich mulmig. Denn bis anhin war und ist Journalismus ein Ökosystem, in dem jede Redaktion auf die Vorleistungen vieler anderer Redaktionen angewiesen ist.
Wenn wir hochwertige Medienangebote erhalten wollen – also Journalismus, der hinreichend unabhängig agiert und für das Gemeinwesen meritorische Güter bzw. Dienstleistungen produziert –, dann ergeben sich eine Reihe von Herausforderungen.
Noch kaum erkannt, könnte die vielleicht wichtigste Herausforderung sein, die Publika über Journalismus und über Medien aufzuklären: Weder gebührenfinanziertes Fernsehen noch werbefinanzierte Printmedien sind «umsonst». Wir, die Bürger und Konsumenten, werden allemal zur Kasse gebeten – indirekt, sei das in Form einer steuerähnlichen Gebühr, sei das beim Einkauf der lila Kuh oder des Markenwaschmittels an der Supermarktkasse. Im Prinzip ist es besser und ehrlicher, wenn mündige Bürger selbst entscheiden dürfen, welchen Journalismus sie konsumieren wollen, und wenn sie für den, den sie haben wollen, direkt bezahlen.
«Yes, we can»
Dem bisherigen kollektiven verlegerischen und journalistischen Versagen bei dieser Aufklärungsarbeit wäre also ein «Yes, we can» entgegenzusetzen. Wenn Greenpeace, Max Havelaar und andere NGO es schaffen, uns auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam zu machen oder zumindest in Marktnischen Fair-Trade-Konditionen durchzusetzen, dann müsste es eigentlich den Medien, die hochwertigen Journalismus anbieten, auch gelingen, uns die Risiken von Informationsmüll und medialer Umweltverschmutzung bewusster zu machen. Bisher haben aber weder die Verleger noch der Service public das so richtig gewollt – im Kampf um Quoten und Auflagen verunstalten vielmehr alle die Landschaft, die einen mehr, die anderen weniger.
Ein Großteil des Überangebots, das Medien heute hervorbringen, ist nur bedingt im öffentlichen Interesse. Was wir über die Drogenexzesse von Amy Winehouse und über Paris Hiltons Strapse erfahren, müssen wir nicht wissen. Die Angelsachsen – daran erinnert uns eine Studie des Reuters Institute in Oxford – machen deshalb den feinsinnigen Unterschied zwischen «the public interest» und «the public’s interest». Was von öffentlichem Interesse ist, ist eben nicht dasselbe, was die Öffentlichkeit oder irgendwelche Öffentlichkeiten interessiert.
Sollte dieses Aufklärungsprojekt scheitern und sollte es damit einhergehend misslingen, die Pay-Walls durchzusetzen, über die Murdoch, aber auch die «New York Times» und die Axel Springer AG seit Monaten diskutieren und die wir brauchen, um Qualitätsjournalismus über den freien Markt zu sichern, dann sind in Europa und in der Schweiz heftige Verteilungskämpfe um die Konzessionsgelder vorhersehbar.
Wer verdient Gebühren?
Letztere werden sich nicht beliebig vermehren lassen. Anderseits wird es dann nicht mehr mit den Almosen getan sein, die bis jetzt in der Schweiz die privaten Presse-, Fernseh- und Radioanbieter vom Steuer- bzw. Gebührenzahler erhalten. Wenn es weiterhin ein funktionierendes journalistisches Ökosystem geben und es dabei halbwegs gerecht zugehen soll, wird man die Konzessionsabgaben neu verteilen müssen. Denn online machen ja nicht mehr die einen Fernsehen und Radio und die anderen Print, sondern – Stichwort Konvergenz – alle alles.
Wenn wir kollektiv Qualitätsmedien wollen, ohne individuell dafür zu bezahlen und ohne sie aus Werbung finanzieren zu können, dann ist Außenpluralismus besser als Binnenpluralismus. Soll heißen: Dann haben die Tageszeitungen und andere journalistische Anbieter für ihre Online-Offerten im Prinzip das gleiche Anrecht auf Konzessionsgelder wie die SRG.
Nur: Wer dann wie darüber entscheiden soll, was von öffentlichem Interesse ist und wer Gebühreneinkünfte erhält, wissen wir bis jetzt nicht. Gewiss, es gibt dafür ausgeklügelte Modelle, um Staatsferne zu gewährleisten. Aber machen wir uns nichts vor: Jeder Akt solch wohlwollender Mittelvergabe ist zugleich auch ein Akt der Zensur demjenigen gegenüber, der leer ausgeht.
Die bisherige Erfahrung auf dem Fernsehmarkt zeigt jedenfalls, dass es nur sehr unzureichend gelungen ist, sich gebührenfinanziert allein auf das zu beschränken, was im wohlverstandenen öffentlichen Interesse sein könnte. Interessen am Eigenbestand und Expansionsdrang haben dazu geführt, dass die meisten Konzessionsgelder dort ausgegeben werden, wo sie unmittelbar mit den Privaten konkurrieren und die Preise treiben, also für Sportrechte, für Gottschalk und für Soap-Operas – nicht etwa für Auslandskorrespondenten und investigativen Journalismus.
Im «öffentlichen Interesse» ist deshalb zuvorderst publizistischer Wettbewerb. Ihn zu ermöglichen und auf hohem Niveau zu erhalten, ist die eigentliche Herausforderung für einen wohlverstandenen Service public. Für diesen Wettbewerb ist Außenpluralismus, also möglichst eine Vielzahl von Anbietern, die hochwertig und nach professionellen Kriterien Journalismus produzieren, wichtiger als Binnenpluralismus, also die Meinungs- und Stimmenvielfalt innerhalb einer Redaktion oder eines Medienunternehmens. Wie wir diesen Außenpluralismus künftig sichern wollen, ist die Gretchenfrage. Gelingt dies, beantwortet sich die Frage, was Medien im öffentlichen Interesse leisten können, wie von selbst.
Schlagwörter:Gratiskultur, Internet, Konvergenz, Schweiz, Service public, USA