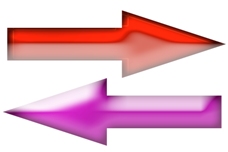 Gibt es eine Übermacht der PR? Und wenn ja, führt PR Böses im Schilde?
Gibt es eine Übermacht der PR? Und wenn ja, führt PR Böses im Schilde?
Was kann die PR zur Beantwortung beitragen? Gäbe es diese Übermacht, würde PR sie leugnen. Führte PR Böses im Schilde, glauben Sie im Ernst, dass ausgerechnet PR dieses eingestehen würde?
Public Relations, das meint Kommunikationsmanagement im Wege persuasiver Kommunikation auf der Basis eines ökonomisch bewehrten Interesses. Das ist keine Disziplin der Selbstkritik. Und es ist kein Gewerbe übermäßiger Transparenz. Hier stellt man sein Licht vorsätzlich unter den Scheffel. Da gilt das Roosevelt-Motto: „Speak softly, but carry a big stick!“ Eigentlich bin ich mit einer Selbstbestimmung der PR überfordert.
Zweite Überforderung, nun zu der publizistischen Welt, die uns umgibt. Von welchen Medien reden wir? Ist dies die geordnete Welt, wie sie einst die Seite 1 der FAZ spiegelte? Mit Trennung von Meldung und Meinung, von Bericht oder Nachricht und Kommentar und mit der Trennung von Redaktion und Werbung? Hat nicht spätestens das Feature und dann das Internet all diese Sortierkästchen weggefegt? Journalismus ist, schmerzlich aber wahr, für alle jüngeren Generationen keine Profession mehr. Der Wert von Wikipedia liegt darin, so lernen wir, dass hier keine Experten schreiben; Expertise von Nicht-Experten, das ist neuerdings Leitkultur.
Einfluss der PR steigt
Schließlich zum Unterschied von Journalismus und PR. Was auf unseren Baustellen der polnische Billiglöhner beim Fliesenlegen, ist der Journalist im PR-Geschäft. Aber das ist nicht nur individuelles Vergehen, sondern mittlerweile Geschäftspraxis. Kaum ein Verlag, kaum eine Redaktion, die heute nicht auch PR anbietet und hinter den Kulissen Corporate Publishing und Redaktion in vielfältiger Weise verschränkt.
Hört man dazu die Gralshüter der Vierten Gewalt, fühlt man sich wie aus der Zeit gefallen. Sie reden, als stehe der Sündenfall noch bevor und man könne Adam noch raten, nicht in Evas Apfel zu beißen. Da draußen im Lande, wie man im Parlament sagt, ist aber nicht der Garten Eden, sondern Sodom und Gomorrha.
Die Presse, so man ihr eine öffentliche Aufgabe zubilligt, was wohl eine allgemein politische Rolle, vulgo Vierte Gewalt, meint, wird zunehmend von PR abhängig, kann aber nicht ohne Weiteres von einer einzelnen PR gesteuert werden. Steuert PR die Presse: ja und nein! Wir haben es mit einem relativ autonomen, aber multikausal bestimmten System zu tun, dessen Überdetermination durch PR zunimmt.
Der Einfluss der Public Relations überhaupt auf die freie Presse, wenn man darunter unabhängige Redaktionen versteht, steigt. Er hat sogar ein Ausmaß angenommen, das es angebracht erscheinen lässt, von der Gefahr eines Systembruchs zu reden. Dazu gibt es empirische Hinweise aufgrund unterschiedlicher Methode und folglich in unterschiedlicher Qualität. Man kann die Anzahl von Pressemitteilungen mit der Anzahl der erschienenen Artikel zu einem Anlass oder Thema vergleichen. Oder die Angehörigen der beiden Berufsstände „Pressesprecher“ versus „Journalisten“ einem headcount unterziehen. Oder die Selbstbefindlichkeit von Journalisten mittels Fragebögen zum normativen Kanon stilisieren. Oder Verstöße gegen die Ehrenkodizes in Presse- oder Werbe- oder PR-Wächterräten zählen. Das ist aber alles, obwohl akademische Praxis, recht vordergründig.
Das ökonomisch wirklich basale Moment ist die von Verlegern betriebene industrielle Rationalisierung von Redaktionen und die vorsätzliche Externalisierung von Redaktionskosten auf sogenannte Content-Provider, von denen man wissen kann, dass sie das Gratisangebot verdeckt durch eine dritte Quelle finanzieren, also einem dritten Interesse folgen. Redaktion kostet, PR gibt es gratis, das ist ein Verleger-Gospel. Die Pressefreiheit hat einen klaren Feind, die Verleger. Und der Presserat ist, wenn ich das überspitzt sagen darf, die PR-Agentur der Verleger zur Nebelung des systematischen Tatbestands durch akzidentielle Kritik.
Bunga-Bunga
Geläufig ist die Diskreditierung von Reise- und Motorjournalismus als PR-gesteuert, aber dies ist zugleich eine wohlfeile Heuchelei und eine arrogante dazu, insbesondere der Herren in der Wirtschaft und im Feuilleton und allemal der Großkopferten in der Politik. Motorjournalisten haben in aller Regel das Auto, über das sie urteilen, auch tatsächlich selbst gefahren. Zugegeben, unter angenehmen Rahmenbedingungen, aber eben doch unter tatsächlichem Augenschein. Niemand kann behaupten, dass dies auch für die Wirtschafts- und Finanzpresse oder gar die Politik gelte. Hier reden allzu oft halb-qualifizierte Laien von Produkten, die sie nicht wirklich verstehen. Die Beispiele aus der letzten Finanzkrise sind Legion. Motorjournalisten haben wenigstens einen Führerschein. Aber die mangelnden Fahrkünste der Teilnehmer an den Börsenrallyes sind eher ein peripheres Problem. Es kommt schlimmer.
Eines der Kernprobleme der Wirtschaftsberichterstattung liegt darin, dass alle Nachrichtenagenturen in den Händen derer sind, die die Geschäfte betreiben. Es herrscht Stamokap allenthalben. Bloomberg scheint mir für diesen Tatbestand paradigmatisch: erst Broker, dann Nachrichtenagentur, dann Bürgermeister. Geschäft, Medien und politische Macht in einer Hand. Ich könnte das Bloomberg-Paradigma an Berlusconi extemporieren. Die Betroffenen bieten uns Bunga-Bunga, damit wir die wirklichen Fragen nicht stellen.
Mein Einwand ist aber fundamentaler als die PR-Färbung dieses oder jenes Tenors. Das ist Kosmetik. Mein Einwand bezieht sich auf die systematische Integration der Funktionen „Geschäft“, „Politik“ und „Presse“ im Mediensystem. Ich wähle eine Metapher aus der Welt der Sportwetten, weil Börse im Kern nichts anderes als wetten ist. Wie geht das überhaupt, dass die Mitspieler eines Spiels zugleich auf den Ausgang des Spiels wetten dürfen? Wetten sie, wie sie spielen werden? Oder spielen sie, wie sie gewettet haben? Diese Frage ist von fundamentaler Bedeutung für die Kapitalmärkte, die über Wohl und Wehe ganzer Nationen entscheiden.
Bleiben wir kurz: Die Presse wird in einem integrierten System zu einer Funktion der Geschäfte und der Politik. Nicht immer einer einzelnen Parteipolitik. Nicht immer eines einzelnen Geschäfts. Aber immer öfter Funktion. Wenn also PR früher mal in einem Anbietermarkt agierte, so agiert PR heute zunehmend in einem Nachfragemarkt. Das ist die ökonomisch und publizistisch fundamentale Änderung. Hier hat der polemische Satz seinen Ort, dass man als PR-Manager gar nicht so viel lügen könne, wie die journalistische Nachfrage es verlange.
PR ist der Parasit einer freien Presse
Das ist Ihnen vielleicht zu polemisch, um analytisch belastbar zu sein. Also formuliere ich es vorsichtiger: Schon immer hat der arbeitsscheue, aber meinungsstarke Journalismus als sein Naturrecht begriffen, dass Stakeholder ihre Interessen in aufbereiteter Form zur Veröffentlichung anbieten müssen. Man reklamiert die Informationspflicht von Behörden, überträgt sie auf Unternehmen und weitet den Anspruch auf Informationen zur Sache auf ein Recht zu O-Tönen und TV-Interviews aus. Sonst heult die Journaille scheinheilig auf. Mit dem wachsenden Einfluss von Kapitalmärkten stützt sich dieses Begehren auch auf das Recht von Aktionären zu wissen, wie die Dinge so laufen. Im Politischen ist dies die Partizipationskultur, die sich der repräsentativen Demokratie auf die Schultern hockt. Folglich entsteht der Beruf des vorjournalistischen Informationsaufbereiters, vulgo Pressesprecher oder PR-Manager.
Eine ökonomische Sonderform, über die man nachdenken muss: Da diese Dienstleistung nicht vom Nachfrager bezahlt wird, sondern vom Anbieter, ist konkludent, dass ihr eigentlicher wirtschaftlicher Wert in einem mehr oder weniger verborgenen Zusatznutzen für den Anbieter bestehen muss. Deshalb ist die polemische Metapher zutreffend, dass PR der Parasit einer freien Presse ist; Gesundheit des Wirtstieres willkommen. Die Rechnung bezahlt der Leser, die Gesellschaft, das Gemeinwesen.
Relevant für den Zustand des Gesamtsystems ist nun die Frage, ob es sich bei dem PR-Einfluss um eine Nebenfunktion oder gelegentliche Störfälle eines ansonsten intakten Systems handelt (Unterdetermination) oder ob die Funktionalisierung von Journalismus schon so weit gediehen ist, dass die Strukturen an der Oberfläche nicht mehr den Tiefenstrukturen entsprechen (Überdetermination). Sieht aus wie Presse, ist aber PR. Die Verlässlichkeit der Information besteht dann nur noch in Folge der Vielzahl der PR-Einflüsse, die sich idealiter die Waage halten. Oder in einem Chaos, das sich einer diktatorischen Vereinheitlichung verschließt. Damit wechselt „check+balances“ in die PR, die zum eigentlichen Regulator geworden ist. Im publizistischen System wechselt die Reglerleistung von relativ autonomen Redaktionen auf eine Angebotsvielfalt von PR, in der viele eine große Chance haben, da die spezifischen Kosten dramatisch sinken; im Web sinken sie linear gegen Null. „Have your say“: das ist der neue Imperativ an jedermann.
Ich argumentiere im Sinne einer Kybernetik der zweiten Ordnung, erspare Ihnen aber den Wissenschaftsjargon. Der Journalismus selbst diskutiert diesen Strukturwandel in der Metaphorik der Dekadenz, eines Sittenverfalls, gegen den man moralisch zu stehen habe, um den Titel eines larmoyanten Selbstvergewisserungsbuches aus journalistischer Feder zu zitieren. Da erscheint PR als Beelzebub, dem zu widerstehen ist. Ach je, da schaffen sich die Herren Redakteure kleine Teufelchen der Versuchung und brüsten sich mit Unabhängigkeit gegenüber diesen Phantasiegestalten. Not good enough.
Die Einhaltung der vier I
Verteidigen müsste die professionellen Privilegien der Journalisten, zumindest akzeptable Arbeitsbedingungen, eine gewerkschaftliche Organisation der Journalisten. Der DJV ragt an seine Aufgaben nicht mal ansatzweise heran. Er selbst ist PR-durchtränkt und PR-geleitet. Ein schlechter Witz prätentiöser Apparatschiks. Der Niedergang der Publizisten ist auch daran zu erkennen, dass er in diesem Land nicht ernsthaft diskutiert wird. Stimmen von Gewicht hört man allenfalls im „Netzwerk Recherche“, das sich in einer großen Geste gegen die journalistische Alltagswirklichkeit zusammengefunden hat.
Gefährdet PR eine freie Presse, indem sie die Medien steuert? Dazu gebe ich vier Antworten:
1. PR ist eine gegenläufige kommunikative Rolle zu der des Journalisten. Verleger müssen ihre Redaktionen so stellen, dass sie PR nutzen können, aber nicht PR unterliegen, weil ihnen hinreichende Arbeitsbedingungen entzogen werden. Aus der Perspektive eines Journalisten ist eine einzelne interessengebundene Einflussnahme gut zu wissen, aber als einzelne prinzipiell problematisch, und das heißt: immer zu problematisieren. Jede Quelle ist suspekt. Das wissen gute Historiker. Man macht sich im Interesse der Meinungsbildung des Bürgers mit keiner Sache gemein, auch nicht einer guten.
2. PR ist ordnungspolitisch unproblematisch, solange Identität, Interesse, Ideologie und Intention prinzipiell erkennbar sind. Das ist meine Theorie der vier I. Da PR aber genau diese Transparenz systematisch, nicht nur akzidentiell, zu vermeiden versucht, ist PR auch akzidentiell problematisch. Jede Quelle ist suspekt. Das wissen, wie gesagt, gute Historiker. Man macht sich mit keiner PR gemein, auch nicht einer transparenten.
3. Ob die Waffengleichheit von Pressesprechern und Journalisten noch besteht oder das System kippt, ist eine so wichtige Frage, dass man sie fallweise und konkret zu beantworten hat. Wir kennen Fälle, in denen Funktionalisierungen des Systems Tiefenstrukturen nachhaltig ändern, sodass die Anmutung eines Systems nicht mehr sein wirkliches Wirken erkennen lassen. Jeder Wahrheitsanspruch ist suspekt. Man macht sich mit keiner Wahrheit gemein.
4. Die Branchenpolitiker der PR und jene Professoren, die sie dabei willfährig alimentieren, teilen meine Sicht der Dinge entschieden nicht. Man ist mit Bezug auf berufsethische Kodizes bemüht, PR zu einem Instrument der Wahrheitspflege und einem originären Ausdruck demokratischer Kultur zu stilisieren. Ein Wächterrat will Regelverstöße sanktionieren. Das aber ist keine Selbstregulierung. Es ist der Versuch, Kritiker in den eigenen Reihen mundtot zu machen. Ich selbst bemerke das Wirken des Wächterrates vor allem darin, dass die hier vorgetragenen Überlegungen einer Zensur unterzogen werden sollen. Weil man, das ist die eigentliche Agenda, PR für PR machen möchte. Weil man Glaubwürdigkeit für sich reklamiert.
Die Fünfte Gewalt plustert sich gegenüber der Vierten. Wenn das angemessen wäre, was dort normativ über PR gesagt wird, dann könnte man die Redaktion getrost gleich ganz nach Hause schicken. Dann fragen wir künftig Doktor Marlboro, ob Rauchen gesund ist. Und Angela Merkel, ob die Regierung was taugt. Vielleicht sollte man die Zeitungen dann auch Prawda, zu deutsch: Wahrheit, nennen.
Soweit meine vier Thesen. Sie sehen, dass ich auch vor der eigenen Tür zu kehren suche.
Ich fordere also von meinem Berufsstand die Einhaltung der vier I: prinzipielle Erkennbarkeit von Identität, Interesse, Ideologie und Intention. Und ich sage den Journalisten: Sie müssen immer und überall davon ausgehen, dass genau damit gespielt wird. Nicht als Unfall oder Zufall, sondern systematisch.
Presse ist Rhetorik
Aber noch mal zum Kippen des Systems: In dieses Spiel dringen jetzt alle großen und kleinen Redaktionen ein, indem sie selbst PR als Dienstleistung anbieten. Und unverhohlen die redaktionelle Expertise als Consulting verkaufen und dabei verhohlen redaktionelle Abdeckung anbieten.
Wenn aber nun Einzelfälle um herausgehobene PR-Manager, die es gibt oder nicht, Schlagzeilen machen, die die Grenzen zwischen Information und Desinformation, zwischen Beratungsgewerbe und organisierter Kriminalität verwischen, so ist das kein Problem meiner Position. Ich habe ja alle Beteiligten hinreichend gewarnt. Es ist ein Problem jener Chefredakteure, die vor diesen spin doctors auf und ab wieseln. Diese Schattengestalten werden, so hört man, in den Chefredaktionen hofiert, weil – Sie kennen mein Argument – PR kein Anbietermarkt mehr ist, sondern ein Nachfragemarkt. Das Spindoctoring ist, ökonomisch präziser formuliert, in die Rolle des umworbenen Lieferanten gebracht worden, dessen Rohstoffe man für das herzustellende Produkt dringend braucht, weil eben dieses Produkt Ware ist, in einem wettbewerbsintensiven Nachahmungsmarkt. Desinformation versucht man, wenn es eben geht, zu verhindern, aber lieber eine faule Story mitgeschleppt, als sie den anderen Blättern gelassen. Vor dieser Tür müssen die Journalisten kehren.
Ich schulde Ihnen zum Schluss noch eine positive Bestimmung dessen, was Presse ist, nämlich eine Form öffentlicher Rede, an die besondere Anforderungen gestellt werden. Systematisch betrachtet sind Presse wie PR wie Werbung Formen der Rhetorik. Presse ist kein Institut der Wissenschaft, also nicht den Kriterien von Redlichkeit und Wahrhaftigkeit unterworfen. Presse ist Rhetorik. Unter Rhetorik verstehen wir seit der griechischen Antike Formen der öffentlichen Rede, die wirkungsbezogen sind. Dass dabei der Presse, so wie wir sie in den letzten Jahrhunderten normativ verstehen, eine besondere Funktion zukommt, dass sie also eine besondere Form der Rhetorik darstellt, will ich an ihren neuzeitlichen Entstehungsbedingungen, also historisch, erklären.
Lloyd’s List
1696 gründet Edward Lloyd in seinem Londoner Kaffeehaus Lloyd’s List die älteste, bis heute kontinuierlich erscheinende Zeitung. Und sie sollte „reliable, but terse“ sein, „verlässlich, aber kurz“ – das ist bis heute die Wesensbestimmung von Presse. In welchem Kontext also entstand der Wunsch nach Reduktion von Komplexität und referentieller Präzision? Gebrauchswahrheiten, das sind die Produkte der Journalisten. Im Kaffeehaus des Herrn Lloyd saßen „sailors, merchants and shipowners“; man handelte mit Versicherungen für die Frachten auf den Weltmeeren. Es wird Seemannsgarn ohne Ende gesponnen. Und es gab ein originäres Interesse daran zu wissen, ob ein überfälliges Schiff nur verspätet oder bereits gesunken war. Eine Glocke wurde zu diesem Zweck geschlagen.
Es ging wirtschaftlich nicht um Kleinigkeiten. Und es waren keine Geschäfte der vornehmen englischen Art, also nur tea parties. Die Engländer strebten die Vormachtstellung im Sklavenhandel an. Weit über drei Millionen Sklaven gingen durch die Bäuche der Schiffe ihrer Majestät und zwischen 1689 und 1807 wurden aus der Flotte der englischen Sklavenhändler gut 1000 Schiffe als verloren gemeldet. Große Geschäfte also, gute Profite. Auch damals, in seinen Kindertagen, war der Kapitalismus das, was er heute ist, eine krisengeschüttelte Veranstaltung zwischen Staat, Banken und Börsen. Ich komme zur South Sea Bubble, entstanden aus einer wilden Spekulation um ein einziges Unternehmen, die schließlich den gesamten Aktienmarkt des frühen 18. Jahrhunderts ergreift. Die folgenden Ausführungen fußen auf einen Artikel der FAZ vom 2.7.2008: „Ihren Anfang nahm die Südseeblase im Jahr 1711.
Mehrere britische Banker gründeten in diesem Jahr die South Sea Company. Der eigentliche Geschäftszweck war jedoch weniger der Handel mit der „Südsee“ und später mit Sklaven, als vielmehr die Übernahme eines Teils der britischen Staatsschulden in Höhe von zunächst 10 Millionen Pfund. Im Gegenzug erhielt die Gesellschaft eine Verzinsung von 6 Prozent und das Monopol für Handelsgeschäfte mit den spanischen Kolonien in Lateinamerika. Vor allem aber wurde der South Sea Company die Erlaubnis zu teil, zur Finanzierung der Schuldenübernahme eigene Aktien auszugeben. (…) Tatsächlich fand durch die South Sea Company bis zum Jahr 1717 gar kein Handel mit den südamerikanischen Kolonien statt. Auch später sollen die Geschäfte wirtschaftlich kaum der Rede wert gewesen sein.
Was allerdings mit der Zeit in der Tat florierte, war der Handel mit Sklaven. Sie wurden von Westafrika nach Amerika verschifft und dort verkauft. (…) Der eigentliche Südsee-Boom begann erst im Jahr 1719, als die Gesellschaft zum zweiten Mal Staatsschulden in Höhe von 1,7 Millionen Pfund übernahm und dies abermals durch die Ausgabe neuer Aktien finanzierte. Im Jahr 1718 war es wieder zum Krieg mit Spanien gekommen, die Schulden Großbritanniens wuchsen. Anfang des Jahres 1720 machte schließlich die South Sea Company dem britischen Staat das Angebot, einen Großteil der Verbindlichkeiten zu übernehmen, wenn sie im Gegenzug dazu Kapital unbegrenzt und zu jedem Kurs erhöhen könne.
Ein entsprechendes Gesetz trat kurz darauf in Kraft. Der Gesellschaft wurde es erlaubt, Aktien im Nominalwert von insgesamt 31,5 Millionen Pfund zu begeben. Die Rechnung war einfach: Je höher der Ausgabekurs, desto weniger Aktien reichten für die Übernahme der Schulden und desto höher war der Ertrag. (…) Die Südsee-Maschinerie begann zu laufen. Der Aktienkurs der South Sea Company hatte sich bislang kaum bewegt. Anfang 1720 stand er bei 128 Pfund – bei einem Nominalwert von je 100 Pfund je Aktie. Im Laufe dieses Jahres erfolgte nun wiederholt die Ausgabe neuer Aktien zu immer höheren Kursen. Zeitgleich fachten gezielte Äußerungen des Direktoriums der South Sea Company über hochprofitable Geschäfte und versprochene Dividendenzahlungen in enormer Höhe das Interesse der Investoren und die Kurse immer weiter an. Die verheißungsvollen Gewinnchancen trafen schließlich auch unter immer mehr Privatanlegern auf fruchtbaren Boden.
Das Geld der Interessenten reichte längst nicht mehr. Ratenzahlungen bei der Kapitalerhöhung würden üblich und Kredite aufgenommen, um die Aktien der Gesellschaft überhaupt kaufen zu können. Gleichzeitig startete an der Londoner Börse das Optionsgeschäft mit den Aktien. Die Begeisterung der Investoren gipfelte schließlich in einer regelrechten Südseemanie. Alles, was auch nur im Entferntesten mit diesem Thema zu tun hatte, war gefragt. Der Kurs der Aktie schoss in dieser Euphorie empor und kletterte im August 1720 in der Spitze auf mehr als 1000 Pfund. Längst konzentrierte sich das fieberhafte Interesse der Anleger nicht nur auf die Aktien der South Sea Company.
Mehr und mehr Unternehmen wurden zu Trittbrettfahrern und drängten an die Börse. Ähnlich wie später zu Zeiten des Neuen Marktes fanden inmitten des Booms selbst windigste Geschäftsideen bei potentiellen Geldgebern reißenden Absatz. Aktienkäufe auf Kredit waren üblich. Die Aktienkurse schossen binnen weniger Monate empor. Nach dem rasanten Höhenflug kam das böse Erwachen: Die Südseeblase platzte im Jahr 1720, die Kurse stürzten ab. Zahllose Anleger – vom Bauern bis zum Adligen – waren der Versuchung erlegen und verloren ihr Hab und Gut. Auch für die britische Wirtschaft blieb sie nicht ohne Folgen.
In der nachfolgenden Baisse schwappte eine Welle von Bankrotten über das gesamte Land. Die Folge war eine allgemeine Rezession. Handel und Produktion gingen zurück, nachdem mehrere Investoren hohe Summen (einige 10.000 ₤) verloren hatten. Die leitenden Mitarbeiter der South Sea Company wurden von der britischen Regierung verantwortlich gemacht und juristisch verfolgt. Einige landeten im Gefängnis, andere begingen Selbstmord oder flohen ins Ausland. Die South Sea Company wurde nicht aufgelöst und handelte in Friedenszeiten weiter, bis sie in den Reformen der 1850er aufgelöst wurde. Die Kosten wurden von der East India Company und der Bank von England getragen. Der Administrator dieser Lösung war der Schatzkanzler Robert Walpole, der dadurch seine große Macht in Großbritannien begründete. Den passenden Kommentar zum Börsencrash lieferte der Physiker Isaac Newton, der selbst 20.000 Pfund verlor: Ich kann die Bewegung eines Körpers messen, aber nicht die menschliche Dummheit.“
“Korrekt, aber kurz und knackig”
Es gab also hinter all dem Seemannsgarn Geschäfte und Gerüchte. Und es gab große literarische Talente bei Herrn Lloyd. So trat ein Journalist namens Daniel Defoe 1719 mit einem Tatsachenbericht hervor, der den Titel trug: „The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner: who lived Eight and Twenty Years, all alone in an uninhabited Island on the coast of America, near the Mouth of the Great River of Oroonoque; Having been cast on Shore by Shipwreck, wherein all the Men perished but himself. With An Account how he was at last as strangely deliver’d by Pirates. Written by Himself.“ Nein, erdichtet von einem Journalisten, der zum Schriftsteller wurde. Alles erdichtet, sprich gelogen. Wehe, wer da sein Geld reinsteckte.
In dieser Welt wollte man neben den Gerüchten und den Geschichten „reliable shipping news“, weil alles andere zum Ruin führen konnte. Mit dem Auftrag „korrekt, aber kurz und knackig“ („reliable, but terse“) wird die Presse geboren. Eine Sonderform, die der Gemeinschaft der Geschäftstreibenden hilft, nicht auf jede Grille oder jedes Gerücht hereinzufallen. Die Presse steigt als Phönix des gemeinsamen Interesses aus der Asche verbrannter Spekulationen. Sie soll das Dritte sein, zwischen Geschäftemachern und Geschichtenerzählern. Sie kann diese Aufgabe erfüllen, solange alle ihre Aufgabe gemeinschaftlich wollen. Und bereit sind, für diese Dienstleistung angemessen zu zahlen.
Die Citoyen müssen sich in der Presse über die Bourgeois erheben dürfen, auch wenn wir hier über ein und dieselbe Gruppe reden. Und insofern ist Presse eben nicht Vierte Gewalt, eine Funktion des Gemeinwohls (volonté générale), sondern nur eine Funktion des gemeinsamen Interesses (volonté de tous), gegen das zu verstoßen das Wesen guter Geschäfte sein kann. Citoyen und Bourgeois sind Gegner, nicht Partner. PR und Presse als Intereffikation vereinheitlichen zu wollen, ist ein Manöver der Gegenaufklärung.
Demokratie ist kein Ponyhof.
Was propagiere ich? Bei Kant gibt es die Unterscheidung vom öffentlichen und privaten Gebrauch der Vernunft. Mit privat ist bei Kant der Privatwirtschaftliche gemeint. Der Journalist verkaufe seinen Artikel oder sein Blatt, der Pressesprecher sein Anliegen. Oberhalb dessen liegt aber der öffentliche Diskurs darüber, was wir als aufgeklärte Menschen für vernünftig halten. Was uns als Maxime einer allgemeinen Gesetzgebung recht und gut erscheint. Was das moralische Prinzip in uns von uns verlangt.
Leicht geänderte Fassung des Vortrags zum Symposion “Medien und Demokratie”, veranstaltet am 4. Juli 2011 in Bonn von der Demokratie-Stiftung an der Universität zu Köln.
Schlagwörter:Demokratie, Einfluss, Fünfte Gewalt, Journalismus, Lloyd’s List, Medien, PR, PR & Marketing, Presse, Pressefreiheit, Steuerung, vierte Gewalt




















