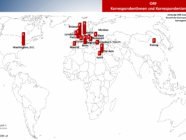Was die Wissenschaft zu öffentlichen Debatten über Qualität leisten kann – und was nicht.
Medienwissenschaftler und ihre Studien stoßen unter Journalisten und Managern regelmäßig auf Abwehr. Im Folgenden äußert sich ein Professor zum Verhältnis von Wissenschaft, Politik, Öffentlichkeit und Medien. Der angewandten Kommunikations- und Medienwissenschaft weht gegenwärtig aus der medialen Öffentlichkeit ein rauer Wind entgegen. Die Betreiber der Windmaschinen reagieren säuerlich auf die Publikation von Studien, die fünf Teams aus verschiedenen Forschungsstätten zur Lage der Presse und der elektronischen Medien in der Schweiz durchgeführt haben.
Steine des Anstoßes
Beauftragt wurden die Medienwissenschaftler vom Bundesamt für Kommunikation (Bakom). Dort macht man aus den 634 Seiten sowie aus den Stellungnahmen der Medienbranche dazu für den Bundesrat einen Bericht zu den Zukunftschancen der Presse. Einen solchen Bericht fordert das Postulat „Pressevielfalt sichern“ des SP-Nationalrats Hans-Jürg Fehr. Dieser sieht durch die jüngsten Entwicklungen in der Schweizer Zeitungslandschaft die für die direkte Demokratie notwendige publizistische Vielfalt in den Regionen bedroht.
Weil Prognosen dem Orakel und nicht der Wissenschaft vorbehalten sind, hat das Bakom die politische Fragestellung etwas wissenschaftsfähiger gemacht. Der Auftrag bestand laut öffentlicher Ausschreibung darin, „die wirtschaftlichen Grundlagen von Medienunternehmen zu beleuchten, die Auswirkungen der Medienkonzentration auf die Meinungsvielfalt zu untersuchen, die Zukunftschancen verschiedener Medien zu diskutieren sowie die Auswirkungen des Internets auf Presse, Radio und Fernsehen auszuloten“. Spannend. Insgesamt standen für die fünf Untersuchungen 385 900 Franken zur Verfügung.
Larmoyante Journalisten
Kaum wurden die – eigentlich an die medienwissenschaftlichen Spezialisten des Bakom gerichteten – Studien öffentlich zugänglich gemacht, reagierten manche Journalisten mit mitleiderregender Larmoyanz, ja mit einer wohl erwarteten, aber doch irritierenden Überempfindlichkeit.
Nichts als „belanglose Binsenwahrheiten“ meint der Weltwoche-Kolumnist Kurt W. Zimmermann bei seiner raschen Lektüre gefunden zu haben. Im Polit-Blog von Tagesanzeiger.ch wirft der Chefredaktor von 24 heures, Thierry Meyer, den Forschenden Selbstgefälligkeit vor und beklagt, dass „die Wissenschaft die Presse schlecht mache“.
Etwas genauer gelesen hat Norbert Neininger-Schwarz. Der Verleger und Chefredaktor der Schaffhauser Nachrichten mutierte über Nacht zum Methodenspezialisten und stellt dann in der NZZ genüsslich Vermittlungs- und Verständlichkeitsmängel der Studien zur Schau.
Andrea Masüger, Geschäftsführer der Südostschweiz Medien, ließ seinem Unbehagen auf dem Blog Medienspiegel.ch freien Lauf. Er sieht sich von „Experten umzingelt“, die eine regelrechte Inflation an Untersuchungen bewirkten, auf die niemand gewartet habe.
Wichtige Fragen
Die teilweise zynischen Reaktionen der Journalisten irritieren zunächst angesichts der ernsten Lage, wie diese auch die Studien beschreiben. Wir haben es nicht mehr nur mit konjunkturellen Einbrüchen bei der Presse zu tun, vielmehr ist der Strukturwandel des gesamten Medienbereichs in vollem Gang. Es ist fraglich, ob in Zukunft – gerade auch angesichts der Ressourcenschwäche, erschwerter Arbeitsbedingungen und der vielbeklagten, mangelnden Sachkompetenz – im Regionalen ein aus Werbung und Verkauf finanzierbarer Qualitätsjournalismus möglich ist.
Die eher ernüchternden Detailbefunde zur Qualität der ereignis- und zentrumsorientierten, episodischen Regionalberichterstattung etwa unter den Bedingungen der Medienkonzentration mögen erwartbar gewesen sein. Über die Begriffsbestimmungen und die methodischen Zugriffe soll man natürlich immer streiten können, zumal es bei der Debatte um Qualität um einen schwer fassbaren Begriff geht.
Kritik an Presseförderung
Nicht ohne Brisanz sind schließlich die Interpretationen der Forschenden, welche diese unter Berücksichtigung ihrer Befunde in Bezug auf das Postulat Fehr anbringen. Genau das war ja auch eine ihnen vom Bakom zugewiesene Aufgabe. So äußern einige – gerade auch mit Blick auf den Trend zur Konvergenz – ihre Skepsis zum rückwärtsgewandten Modell der indirekten Presseförderung.
In der Studie von SwissGIS der Universität Zürich werden denn auch Alternativmodelle diskutiert, die eine Journalismus- statt eine Presseförderung in den Regionen ins Auge fassen und auch unabhängige Online-Plattformen berücksichtigen. Einmal beachtet, dürften die Vorschläge die medienpolitische Debatte durchaus anregen.
Es ist zu hoffen, dass die vorliegenden Studien einen relevanten Beitrag zu einer breiten Diskussion über die künftige Presse- bzw. Medienförderung und generell zum Diskurs über Qualität leisten können. Auch die jüngst von FDP-Nationalrat Filippo Leutenegger eingereichte Motion mit dem Titel „Definition Service public“ wird dazu Anlass geben, medienwissenschaftliche Erkenntnisse zu beachten. Diese können dabei helfen, die Diskussionen zu rationalisieren.
Für die öffentlichen Debatten in der Demokratie braucht es aber auch einen Medienjournalismus, der in der Lage ist, nach dem Lesen der Zusammenfassungen der Studien nicht nur mit einem pauschalen und wenig hilfreichen „Wissenschaftsbashing“ zu reagieren. Gelingender Wissenstransfer beginnt anders.
Will die Kommunikations- und Medienwissenschaft auch anerkannte Anwendungswissenschaft sein, so darf sie sich jedoch nicht auf die Position zurückziehen, dass die Dissonanzen zwischen der Wissenschaft und den Medienpraktikern einem gängigen Muster entsprechen und eben Tradition haben. Soll der Wissenschaftstransfer in die Gesellschaft tatsächlich gelingen, so muss die Wissenschaft selbst Verbesserungen ins Auge fassen.
Der Zürcher Kommunikationswissenschafter Ulrich Saxer hat dereinst Prinzipien formuliert, die für erfolgreiche Transdisziplinarität gelten. Diese sollten die Forschenden beim Wissenstransfer anleiten. Sie können auch bei der Selbstdarstellung der Kommunikations- und Medienwissenschaft nach außen Verständnis schaffen für die anspruchsvolle Rolle der Wissenschaft etwa in der Politikberatung.
Wissenstransfer verläuft ideal immer als eine transdisziplinäre und somit problembezogene Kooperation zwischen Wissenschaft und den Repräsentanten außerwissenschaftlicher Bereiche. Es kann also niemals darum gehen, der Wissenschaft den Status der dominanten Produzentin von Wissen einzuräumen, die von oben herab Wissen in die Praxis verteilt. Der Transfererfolg ist abhängig von der Intensität der Interaktion zwischen den Forschenden und ihren Klienten, was auch bedeutet, dass Letztere von den ersten Forschungsschritten an einbezogen werden – und zwar nicht nur als Objekte.
Zu beachten ist, dass jeweils wissenschaftliches Wissen in politisches Wissen umgewandelt wird und dabei verschiedene Logiken aufeinanderprallen. Dies sollte in der Interaktion mit den Klienten transparent gemacht werden. Die Abgleichung darf aber nicht zur Preisgabe von wissenschaftlichen Qualitätsstandards führen oder dazu, dass die Wissenschaft wegen Effizienzansprüchen ihrer Klienten ihre methodologischen Standards aufgibt.
Die Klienten der angewandten Kommunikations- und Medienwissenschaft haben sich im Laufe ihrer jungen Geschichte vervielfacht. Neben den Journalisten und den Medienmanagern sowie den PR- und Werbespezialisten oder den Pädagogen gehören auch die Medienpolitiker bzw. die Behörden dazu. Sie alle sind jeweils anderen spezifischen Sichtweisen verpflichtet, und sie erwarten regelmäßig zu viel oder zu wenig von der Wissenschaft. Die klare Definition der (beidseitigen) Kompetenzen ist hier also notwendig.
Entscheide rationalisieren
Die angewandte Kommunikations- und Medienwissenschaft kann als medienpolitischer Dienstleister zur Verbesserung der demokratischen Medienordnung beitragen, indem sie hilft, politische Entscheidungen zu rationalisieren. Gerade in der Politikberatung, wo der Bedarf nach Prognosen und Planungsgrundlagen groß ist, halten jedoch die Klienten oft Arten von Voraussagen für relevant, welche die Wissenschaft gar nicht exakt leisten kann.
Auch die Klienten müssen wissen, dass es nicht die eine Kommunikations- und Medienwissenschaft gibt, sondern beispielsweise Sozial- oder Kulturforscher, Marktforscher oder Medienlinguisten, die im Wettbewerb untereinander stehen und eine unterschiedliche Affinität zu den Klienten haben. Möglicherweise definieren die einen den Qualitätsbegriff unter Rückgriff auf ein je anderes Paradigma anders als die anderen. Umso wichtiger ist es, unter den am Forschungsprozess Beteiligten Transparenz sowie ein gemeinsames Problemverständnis zu schaffen.
In der medienpolitischen Beratung würde dies beispielsweise ein gemeinsames Verständnis von Medienvielfalt voraussetzen. Eine solche Problemdefinition fehlt offensichtlich in den Konzepten zur Presseförderung. Weil aber die Definition von Problemen immer auch im Hinblick auf Soll-Zustände erfolgt, ist Medienforschung zur Qualität in den Medien gleichzeitig eine implizite Medienkritik. Diese wiederum kann aus journalistischer oder aus verlegerischer Perspektive durchaus lästig erscheinen, was nicht selten ein Grund für das Ablehnen wissenschaftlicher Befunde ist.
Vermittlungsprobleme
Schließlich liegt es auf der Hand, dass die Veröffentlichungen und damit die Vermittlungsqualität der angewandten Kommunikations- und Medienwissenschaft anderen Kriterien zu genügen haben als die Publikationen allein für die Wissenschaftsgemeinschaft. Da öffnen sich Klüfte, denn innerhalb des Wissenschaftssystems werden nur für Letztere – quasi für die Bedienung der Plattformen der internen Kommunikation – Lorbeeren verteilt.
Von den Ornithologen wird zwar nicht erwartet, dass diese selber fliegen können. Aber die Kommunikationswissenschaftler sind mit der hartnäckigen Erwartung konfrontiert, im Rahmen der Transdisziplinarität über die Grenzen der Fachsprache hinaus verständlich kommunizieren zu können. Sollte dies dem Fach noch besser gelingen, werden vielleicht sogar ihre Kassandrarufe von scheinbar tauben Journalisten gehört.
Vinzenz Wyss ist Präsident der SGKM (Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft), Professor für Journalismus an der ZHAW und Mitverfasser einer der hier angesprochenen Studien.
Erstveröffentlichung: Neue Zürcher Zeitung vom 26. April 2011
Schlagwörter:Bundesamt für Kommunikation, Kommunikationswissenschaft, Medienjournalismus, Medienpraxis, Medienwissenschaft, Qualität, Schweiz, Studie, Wissenschaftstransfer