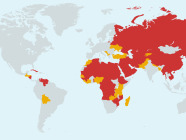Derzeit ist international nur noch die Reputation der krisengeschüttelten Banken- und Autobranche im Blick auf Betrug und Korruption schlechter als die der Medien. Einer Studie von Media Tenor zufolge haben weder die Pharmariesen noch die am Klimawandel ursächlich beteiligte Ölindustrie mehr mit Negativberichterstattung zu kämpfen als die Medienbranche. Sind daran die Journalisten schuld? Oder gar die Kommunikationschefs der Medienunternehmen?
 Jedenfalls ist die Herausforderung damit thematisiert: Wie lässt sich – nach Jahrzehnten nachgewiesenen Vertrauensverlusts – verlorene Glaubwürdigkeit zurückgewinnen? Kommunikationsmanagement in der Medienbranche unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von anderen Industrien und Dienstleistern. Besonders heikel ist es derzeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – denn dort ist inzwischen Krisenmanagement gefordert, auf das die stolzen und trägen Großtanker des Medienbetriebs nicht gut vorbereitet sind. Deren Existenzberechtigung wird in den Nachbarländern Österreich und Schweiz von starken rechts-populistischen Parteien in Frage gestellt – ähnlich wie in Deutschland durch die vergleichsweise noch kleine AfD.
Jedenfalls ist die Herausforderung damit thematisiert: Wie lässt sich – nach Jahrzehnten nachgewiesenen Vertrauensverlusts – verlorene Glaubwürdigkeit zurückgewinnen? Kommunikationsmanagement in der Medienbranche unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von anderen Industrien und Dienstleistern. Besonders heikel ist es derzeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – denn dort ist inzwischen Krisenmanagement gefordert, auf das die stolzen und trägen Großtanker des Medienbetriebs nicht gut vorbereitet sind. Deren Existenzberechtigung wird in den Nachbarländern Österreich und Schweiz von starken rechts-populistischen Parteien in Frage gestellt – ähnlich wie in Deutschland durch die vergleichsweise noch kleine AfD.
In der Schweiz sollte mit der No Billag-Initiative die Rundfunkgebühr nicht etwa eingeschränkt, sondern abgeschafft werden. Letztlich wurde sie aber in einer Volksabstimmung von 71 Prozent der teilnehmenden stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Schweiz abgelehnt. Auch in Deutschland mehren sich Stimmen, die meinen, ARD und ZDF seien überdimensioniert und überbürokratisiert und produzieren zumindest am jungen Publikum vorbei.
Wichtige Multiplikatorenfunktion
Journalisten der Mainstream-Medien machen sich hier allerdings nur selten zum Sprachrohr, vor allem vermutlich deshalb nicht, weil sie privat mit Kollegen aus den Anstalten befreundet sind und eine Krähe der anderen bekanntlich kein Auge aushackt. Womit ein entscheidender Unterschied zum Kommunikationsmanagement in anderen Branchen bereits genannt wäre. In der Versicherungswirtschaft oder in der Ölindustrie sitzen die Journalisten „draußen“ vor der Tür. Das Kommunikationsmanagement lässt sich in solchen Unternehmen hierarchisch hochziehen: Für die Außenkommunikation und damit für Kontakt zu Journalisten ist die Kommunikationsabteilung zuständig.
In der Medienbranche hat es das Top-Management und die Kommunikationsabteilung dagegen mit Journalisten „inhouse“ zu tun. Sie sind zwar längst als Schleusenwärter entthront, die alleinig Öffentlichkeit herstellen, aber sie nehmen weiterhin eine wichtige Multiplikatorfunktion wahr. Alle Redakteure haben Außenkontakte zum Publikum, und zumindest in Großstädten sind die meisten von ihnen auch untereinander gut vernetzt – ein schwer zu bändigender Sack Flöhe. Hier Vorgaben machen zu wollen, was nach außen kommuniziert wird und was nicht, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.
So entstehen zwei potentielle Konflikte: Entweder werden die Journalisten zu Erfüllungsgehilfen der PR-Abteilung – sie machen mitunter ungefragt und im vorauseilender Gehorsam PR in eigener Sache. Was gut gemeint ist, ist jedoch nicht immer gut – und zumindest der klügere Teil des Publikums merkt genau, wenn auf der Mogelpackung „Journalismus“ draufsteht und hauseigene Öffentlichkeitsarbeit drin ist. In solchen Fällen ist allerdings von anderen Journalisten kaum noch Kritik zu fürchten – denn die gucken lieber weg, und Journalismus, der sich mit Medien und Journalismus fachgerecht beschäftigt, wurde ja längst in den allermeisten Medienhäusern wegrationalisiert.
Seltener sind störrische Widersacher in den Redaktionen, aber auch sie können Kommunikationsmanagern eines Medienhauses das Leben schwermachen, indem sie hartnäckig „altmodische“ journalistische Prinzipien verteidigen und sich so elementaren Erfordernissen des redaktionellen Marketings entgegenstemmen. Motto: Wir berichten über alles, nur nicht über uns selbst.
Die andere Herausforderung für das Kommunikationsmanagement besteht darin, dass die Medienarbeit doppelt schwierig ist: Wie gesagt, es fehlen in den Redaktionen, anders als in der Wirtschaft, in der Politik oder im Sport, sachkompetente und zuständige Ansprechpartner. Auch Berichterstattungsplätze sind rar. Dafür hält sich in den Redaktionen vom Chefredakteur bis hin zum Praktikanten jeder für einen „Medienexperten“, der oftmals dazwischen funkt. Zum anderen tun sich die Kommunikationsabteilungen schwer, weil in Zeiten hoher Medienkonzentration jede zweite Medienmitteilung entweder hauseigene Redakteure oder Wettbewerber zum Adressaten hat und letztere nur ungern freundlich über die Konkurrenz berichten. Sind unmittelbar Eigeninteressen im Spiel, wird es schwieriger, ausgewogen und fair zu berichten. Deshalb rückte in Medienhäusern zeitweise die interne Kommunikation in den Vordergrund. Inzwischen, so die Kommunikationschefin Edda Fels (Springer AG) habe allerdings „der Vormarsch der Social Media Grenzen zwischen interner und externer Kommunikation aufgelöst“. Was heute zähle, seien „überzeugende zielgruppen- und plattformübergreifende Strategien“.
Selbst- und Cross-Promotion
Ganz speziell müssen sich öffentlich-rechtliche Sender immer wieder mit ihrem hohen journalistischen Qualitätsanspruch und ihrer Grundversorgungs- und Gemeinwohl-Verpflichtung auseinandersetzen. Allerdings pochen auch private Medienanbieter und deren Interessenverbände darauf, dass die Öffentlich-Rechtlichen Handeln im öffentlichen Interesse nicht gepachtet haben. So wartet zum Beispiel der Verband Österreichischer Zeitungsverleger inzwischen regelmäßig mit einem „Public Value Report“ auf.
Ohne Selbstpromotion geht also in der Medienbranche nichts mehr. Damit stellt sich die Frage, inwieweit diese „nur“ Aufgabe des Kommunikationsmanagements oder zumindest auch der Journalisten ist. Für qualitätsbewusste Redaktionen, die ein anspruchsvolles und gebildetes Publikum bedienen und deshalb auf dessen Vertrauen angewiesen sind, ist das „Ja“ zu Letzterem allerdings ein „Ja, aber“: Die Selbstpromotion sollte Glaubwürdigkeit stärken, statt sie zu unterminieren – sonst tauscht man kurzfristige Gewinne an Aufmerksamkeit mit langfristig schmerzlichen Vertrauensverlusten. Das gilt einmal mehr insbesondere für öffentlich-rechtliche Anbieter, die mit Gebühren komfortabel finanziert sind und deshalb weniger auf Clicks und Einschaltquoten schielen müssen als ihre überwiegend werbefinanzierten privaten Wettbewerber.
Selbstpromotion hat in Editorials und Programmhinweisen ihren Platz, aber sie darf die Nachrichtengebung nicht beeinflussen. An den öffentlich-rechtlichen Rundfunk richtet sich die Erwartung, dass seine Redaktionen unabhängig und insgesamt fair und ausgewogen berichten – was indes pointierte Einzelbeiträge keinesfalls ausschließt, soll er nicht vom Forum für Diskurs-Demokratie zum drögen Staatsfernsehen degenerieren. Geht es um eigene Anliegen, sollten sich qualitätsbewusste Redaktionen Zurückhaltung auferlegen. Mehr Transparenz des redaktionellen Geschehens ist wichtig, Eigenwerbung und Cross-Promotion haben in Nachrichten dagegen nichts zu suchen, und schon gar nicht „journalistische“ Beiträge, die so einseitig von Eigeninteressen geleitet sind, als hätte sie die PR-Abteilung des jeweiligen Medienhauses fabriziert.
Pustekuchen: Dass das oftmals anders ist, wissen Mediennutzer aus der Alltagserfahrung. Beispielsweise betreiben ARD und ZDF in ihren Nachrichtensendungen recht munter Selbst- und Cross-Promotion, indem sie in nahezu jeder Sendung auf ergänzende Offerten in ihrem Web-Angebot verweisen. Kontrovers diskutiert wurde auch mehrfach, ob die ARD durch häufige Nennung der „Rechercheallianz von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung“ in Tagesschau und Tagesthemen ihrem Partner SZ einen unangemessenen Wettbewerbsvorteil verschafft. Medienforscher wie Romy Fröhlich (Universität München) und Volker Lilienthal (Universität Hamburg) verneinen das. Das könnte indes auch damit zu tun haben, dass beide falsch einschätzen, wieviel Schleichwerbung – in der Wiederholungsschleife zur besten Sendezeit – für eine Tageszeitung zu Lasten von deren Konkurrenten wirklich wert ist. Lilienthal nimmt als „Professor für Qualitätsjournalismus“ seine Hamburger Tagesschau-Kollegen noch weiter in Schutz und rechtfertigt die Verweise auf die Rechercheallianz als journalistisch notwendige Quellenangabe. So viel Quellentransparenz wäre dann freilich auch anderswo wünschenswert, zum Beispiel wenn Journalisten PR-Quellen nutzen.
In der Schweiz lässt sich derzeit beobachten, wie solche Unzulänglichkeiten im alltäglichen Kommunikationsmanagement und in der Selbstdarstellung zur Existenzkrise führen können. Ungerecht daran ist, dass die SRG im Vergleich zu ihren öffentlich-rechtlichen Geschwistern bei den „next-door neighbors“ in Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien eher gut aufgestellt ist: Der viersprachige Rundfunkanbieter ist schlanker als die Nachbarn und hat eine hochentwickelte journalistische Kultur. Er konnte bislang seine Unabhängigkeit gegenüber der Politik erstaunlich gut verteidigen. Trotzdem konstatiert Ladina Heimgartner, die stellvertretende SRG-Generaldirektorin, man habe die eigenen Leistungen unzureichend kommuniziert. „Wenn wir als arrogant empfunden werden, ist das unser Problem, nicht jenes der Leute, die uns so wahrnehmen. Ein öffentliches Medienhaus hat nicht arrogant zu sein – Punkt.“
„Fünfte Gewalt“
Der neue Kommunikationschef der SRG Edi Estermann sagt, er habe vom Tag seiner Arbeitsaufnahme 2017 an „im Krisenmodus operiert“: Weil es mit der No Billag-Volksabstimmung um Sein oder Nichtsein ging, tobte in den sozialen Netzwerken eine extrem aufgeheizte, hochgradig polarisierte Auseinandersetzung um den öffentlichen Rundfunk. Kein gutes Klima, um der Stimme der Vernunft Gehör zu verschaffen, sei es durch professionelles Kommunikationsmanagement, sei es durch kompetenten Medienjournalismus. Aber immerhin ein Warnsignal. Es sollte in deutschen Medienhäusern die Einsicht reifen lassen, sich sowohl um die Medien-PR als um den Medienjournalismus verstärkt zu kümmern.
Und wie ließe sich ganz konkret Vertrauen zurückgewinnen? Am einfachsten wohl, indem die Medienunternehmen nicht nur ins Kommunikationsmanagement und in Werbung für ihre Produkte investierten, sondern auch in unabhängigen und sachkompetenten, mithin: in glaubwürdigen Medienjournalismus. Er sollte nicht nur als Abnehmer und Multiplikator von Medienmitteilungen fungieren, sondern als kritischer Widerpart und als „fünfte Gewalt“, welche die Beobachtung von Redaktionen und Medienunternehmen nicht allein Hinz und Kunz in den sozialen Netzwerken überlässt.
Obendrein wäre es wichtig, dass die Forschung Medienunternehmen beim Kommunikationsmanagement begleitet. Wissenschaftliche Analysen sind bisher nicht über die Pionierarbeiten von Romy Fröhlich (Universität München), Diana Ingenhoff/Philipp Bachmann (Universität Fribourg) sowie zuletzt von Dirk Arnold (Universität Leipzig) hinausgekommen. Komplementär dazu hat es immerhin über ein paar Jahre hinweg eine florierende Forschung zum Medienjournalismus gegeben – so lange, bis die Medienunternehmen ihr den Forschungsgegenstand entzogen und die meisten Medienredaktionen aufgelöst oder marginalisiert haben.
Erstveröffentlichung: Kommunikationsmanager Nr. 1 / 2018 (für das EJO leicht geändert und aktualisiert)
Schlagwörter:Glaubwürdigkeit, Kommunikationsmanagement, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, PR, Vertrauen, Vertrauensverlust