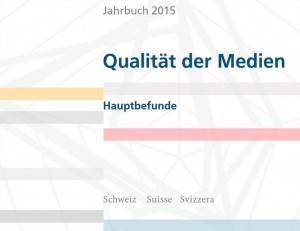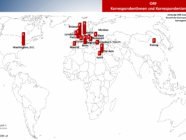- 25Shares
- Facebook24
- E-mail1
- Buffer
Warum sich die Medienforschung bei Medienpraktikern und Medienunternehmen so schwer tut.
Beginnen wir mit den „good news“, mit dem, was neuerdings als „konstruktiver Journalismus“ gefeiert wird: Es ist bewundernswert, wie das Zürcher Forscherteam um Mark Eisenegger „durchhält“. Nach dem unerwarteten Tod von Kurt Imhof, der nicht nur ein großer Medienforscher und ein charismatischer Visionär, sondern auch ein begnadeter Fundraiser war, ist es gelungen, sein Werk fortzuführen. Das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (FÖG) hat neuerlich mit seinem Jahrbuch Qualität der Medien Schweiz auf den schleichenden Verfall einer der wenigen hochentwickelten Journalismus-Kulturen auf unserem Globus aufmerksam gemacht. Das verdient höchsten Respekt.
Das Jahrbuch zeigt zugleich exemplarisch, wie nützlich Medienforschung sein kann – dann jedenfalls, wenn sie in der Medienpraxis „ankommt“. Doch tut sie das wirklich? Vergleicht man die Medienberichterstattung mit dem facettenreichen Originalwerk der Forscher, ist festzuhalten, dass der Forschungstransfer selbst in Glücksfällen nur sehr unzureichend gelingt. So waren die journalistischen Berichte über das Jahrbuch, wie von den Forschern mit ihrer Pressemitteilung intendiert und „ferngesteuert“, stark darauf fokussiert, dass Jugendliche sich mit ihren Smartphones kaum noch für News-Angebote interessieren. Alle anderen Erkenntnisse – sei es zur dramatisch fortschreitenden Medienkonzentration in der Schweiz, sei es zu den Qualitätsverlusten und -gewinnen einzelner Mediengattungen, sei es zum rapiden Wachstum des seichten medialen Unterhaltungsangebots, gingen trotz (oder wegen?) der perfekten Öffentlichkeitsarbeit des FÖG nahezu unter.
Dramatisch unterbelichtet geblieben sind zwei Erkenntnisse: Der Marktanteil des niedrigsten journalistischen Qualitätssegments hat sich innerhalb von nur fünf Jahren von einem Drittel auf knapp die Hälfte des Nachrichtenkonsums ausgeweitet. Das hochwertige Segment ist von 15 auf elf Prozent Marktanteil geschrumpft. Stellen wir uns einmal vor, was in der Schweiz los wäre, wenn im selben Zeitraum in der medizinischen Versorgung die hochwertigen Angebote um 40 Prozent schrumpften, während sich der Sektor der Billigmedizin um rund 50 Prozent ausweitete. Wenn Vergleichbares bei der Informationsversorgung passiert, schert das offenbar kaum jemanden, zuallerletzt jedenfalls die Medien selbst. Die zweite Erkenntnis: Viral verbreiten sich in der Schweiz vor allem News aus dem untersten Qualitätssegment: 20 Minuten/20 Minutes dominiert in den sozialen Medien mit einem Marktanteil von nahezu 50 Prozent, die NZZ bringt es gerade Mal auf ein Prozent.
Die Medienbranche hält sich merkwürdig bedeckt, wenn es um Qualitätsansprüche und um die allfällige Dokumentation von Qualitätsverlusten geht: Erst hat sie sich jahrzehntelang dumm und dämlich verdient – wenn die Geschäfte so gut gehen, kann man ja auf Forschung pfeifen. Dann kam die Krise – und da hat man bekanntlich Wichtigeres zu tun, als sich mit wissenschaftlicher Erkenntnis zu verproviantieren. Stattdessen probiert man in Panik lieber alles nochmal aus, was sich anderswo bereits als unbrauchbar erwiesen hat. So zum Beispiel derzeit beim Tagesspiegel in Berlin, wo der Redaktion über Nacht alle Honorare für freie Mitarbeiter gestrichen wurden. Und dies, nachdem man in den Jahren zuvor die Zeitung mehr und mehr zu einem Autorenblatt umgebaut hatte, das – um seinen eigenen Qualitätsanspruch als Hauptstadtzeitung einzulösen, ohne damit astronomische Redaktionskosten zu verursachen – relativ viele vergleichsweise „billige“ Freelancer einsetzte.
In ganz Europa gibt es meines Wissens nur noch ein Projekt, das sich mit der Arbeit der Zürcher Forscher vergleichen lässt: den ebenfalls jährlichen „Digital News Report“ des Reuters Institute von der Universität Oxford. In den USA ist der jährliche Report „State of the News Media“, den das Pew Research Center vorlegt, das große Vorbild. Gemeinsam ist den Initiativen, dass sie entweder von Stiftungen oder mit Geldern von Banken und Industrie finanziert werden, kaum jedoch von den Medienunternehmen selbst, die eigentlich das größte Interesse an solch kontinuierlicher Branchenbeobachtung haben sollten.
Was indes noch mehr verwundert, ist das Desinteresse der Forschungsförderungs-Organisationen an einem funktionierenden Forschungstransfer: Da werden jährlich Millionen und Abermillionen Steuergelder in die Medienforschung investiert, aber was mit den Ergebnissen passiert, interessiert niemanden. Fehlgeleitete Anreize führen dazu, dass Forscher nur für ihresgleichen publizieren – meist in „peer reviewed journals“, die ohnehin niemand liest, die aber ein Kartell profitgieriger Großverlage obendrein hinter Paywalls verbarrikadiert. Die sich inflationär vermehrenden Journals leben von der Selbstausbeutung der Wissenschaftler – und sind inzwischen so teuer, dass selbst die Bibliothek der steinreichen Harvard-Universität resigniert hat und längst nicht mehr alle ihren Forschern und Studierenden zugänglich macht.
Den Forschern ist das alles ziemlich wurscht – sie freuen sich, wenn ihre Publikationsliste länger und länger wird. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, kümmert es sie in ihrem Elfenbeinturm nicht, ob irgendwer außerhalb der Scientific Community von ihren ja auch nicht immer bahnbrechenden Erkenntnissen je irgendetwas erfährt.
Erstveröffentlichung: Werbewoche Nr.20 vom 6.November 2015
Bildquelle:
- 25Shares
- Facebook24
- E-mail1
- Buffer
Schlagwörter:Digital News Report, Elfenbeinturm, Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (FÖG), Forschungstransfer, Jahrbuch Qualität der Medien, Kurt Imhof, Mark Eisenegger, Schweiz, State of the News Media, Tagesspiegel