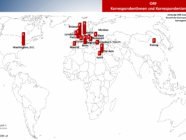- 33Shares
- Facebook32
- LinkedIn1
- Buffer
Eigentlich müsste sie zu den Leitwissenschaften im 21. Jahrhundert gehören: die Kommunikationswissenschaft. Im deutschsprachigen Raum hat sie jedoch einen ausnehmend schweren Stand. Das hat sie sich auch selbst zuzuschreiben.

Auf kommunikationswissenschaftlichen Kongressen fehlt oft die Muße, sich mit kritischen Einwänden auseinanderzusetzen.
„Irgendwas mit Medien.“ Der Studienwunsch vieler Maturanden hat der Kommunikations- und Medienwissenschaft im deutschsprachigen Raum seit ein paar Jahrzehnten einen beispiellosen Entwicklungs- und Expansionsschub beschert. Auch in der Schweiz gibt es inzwischen an nahezu jeder Universität oder Fachhochschule einschlägige Institute, an der Università della Svizzera italiana in Lugano sogar seit den neunziger Jahren eine eigene Fakultät. Weil das Lohnniveau deutlich höher ist als in den EU-Nachbarländern, hat es über Jahre hinweg auch einen Braindrain gegeben: Viele international angesehene Kommunikationsforscher leben und arbeiten im Dreieck zwischen St. Gallen, Genf und dem Tessin.
Paradox ist allerdings, wie wenig die Disziplin in die Öffentlichkeit ausstrahlt – um es polemisch zu formulieren: wie unkommunikativ die Kommunikationswissenschaft ist. In der Schweiz und in den benachbarten Ländern verbleibt das Fach zumeist unterhalb des Wahrnehmungs-Radars der Journalisten – ganz anders als etwa die Geschichtswissenschaft, die Ökonomie oder die Psychologie. Man erfährt in Schweizer Massenmedien üblicherweise nur wenig über den Stand der Kunst – und das in einer Disziplin, die wie keine andere dazu prädestiniert ist, die digitale Revolution und die damit einhergehenden Disruptionen in der Wirtschaft, den Medien und in unser aller Alltagsleben wissenschaftlich zu begleiten.
Keine internationale Resonanz
Um es an einem drastischen Beispiel zu belegen: Vor einiger Zeit fand die Jahrestagung der europäischen Kommunikationsforscher erstmalig in der Schweiz statt – ein Event, der sich auch als Krönung eines jahrelangen Internationalisierungsprozesses der helvetischen Medienforschung sehen lässt. Um „Zentren und Peripherien“ in Zeiten der Digitalisierung sollte es gehen und wie die Kommunikationsforschung diese im digitalen Zeitalter verortet.
Rund 1400 Kommunikations- und Medienforscher aus aller Herren Ländern vereinten sich zum Mammutkongress der European Communication Research and Education Association (Ecrea) und strömten ins entlegene Lugano. Drei Tage lang belebten sie die Tessiner Spätherbst-Tristesse. Doch das Medienecho auf die Veranstaltung blieb karg bis auf ein paar Pflichtberichte im sprachregionalen Fernsehen und in Lokalblättern wie dem „Corriere del Ticino“ – obschon am Kongress Hunderte facettenreicher Befunde zum Zustand und zur Entwicklung der Mediengesellschaft präsentiert wurden.
Ecrea-Konferenzen dieses Zuschnitts finden nur alle zwei Jahre statt, und sie dienen vornehmlich dem Austausch innerhalb der Scientific Community. Es wäre auch zu viel erwartet, dass sich die Teilnehmer wirklich auf ein Tagungsthema einließen, selbst wenn der Bogen weit gespannt ist. Schon ein Blick ins Tagungsprogramm zeigte nicht nur, wie rapide das Fach europaweit aufgeblüht ist, sondern auch, wie es ausfranst: Da gab es Vorträge, die wichtige Einsichten verhießen – zum Beispiel, wie „algorithmische Datenverarbeitung die Fundamente der Kommunikation verändert“ hatten oder wie die Immigration in Tschechien zur „Obsession“ wurde, wohlgemerkt in „einem Land ohne Immigranten“, aber mit einem „hohen Ausmaß von Islamophobie in der Online-Alltagskommunikation“. Daneben aber auch eher Belangloses wie zum Beispiel in der Genderforschung ein Beitrag über „Lesbische Youtubers“, die sich bei ihrem „Comingout“ angeblich zwischen „Authentizität und persönlichem Branding“ bewegen.
Sowohl das auseinanderdriftende EU-Europa als auch das mehrsprachige föderalistische Gastgeberland Schweiz hätten allen Anlass geliefert, um sich vertieft damit zu beschäftigen, wie das Internet, seine Suchmaschinen und seine sozialen Netzwerke unsere Gesellschaften und ihre Mediensysteme umstülpen – und wie dabei eben das Verhältnis von Zentren und Peripherien sich verändert, ja vielleicht sogar in Zukunft diese geografische Dichotomie sich zugunsten virtueller Zentren im Cyberspace auflösen wird. Was indes letztlich fehlte, waren eigene Anstrengungen der Forscher und ihrer europäischen Fachgesellschaft, interessante einschlägige Erkenntnisse herauszufiltern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Es gelang nicht, dem Kongress durch Pressearbeit zu internationaler Resonanz zu verhelfen – trotz den zahllosen Studiengängen, in denen inzwischen Journalismus und Public Relations gelehrt werden, und den Hundertschaften von Studierenden, die sich europaweit für Wissenschaftskommunikation interessieren. Von ihnen hätte man ja zumindest eine Handvoll besonders Talentierter einladen können, um Redaktionen und Social Media mit News zu versorgen.
Englisch ist das neue Deutsch
Als zusätzliche Barriere wirkt bei solchen Veranstaltungen, dass die Kongresssprache inzwischen Englisch ist. Wissenschaftler müssen auch zusehends auf Englisch publizieren, um international wahrgenommen zu werden. Das hat einen kolonisierenden Effekt: Alle anderen Sprachen werden für den Austausch der Forscher untereinander „peripher“.
Die Englisch-Muttersprachler, also vor allem Amerikaner und Briten, dominieren und nehmen bei ihren Präsentationen keine Rücksicht auf Kollegen, die ihnen nur mit Mühe folgen können. Es ist ja offenbar auch nicht so wichtig, was man zu sagen hat – Hauptsache, man hinterlässt einen wortgewaltigen, kompetenten Eindruck. Umgekehrt scheitern Forscher-Kollegen aus nichtenglischsprachigen Ländern, die gewichtige Erkenntnisse zu vermitteln hätten, mitunter daran, dass sie sich radebrechend in den Fallstricken der Fremdsprache verheddern.
An solchen Kongressen wird fast ausnahmslos in parallelen Arbeitsgruppen vorgetragen: im Stakkato, zehn Minuten Präsentation, fünf Minuten Diskussion – der Nächste, bitte. Also immer nur gerade so viel Zeit, um im Supermarkt der Wissenschaften mit Powerpoint-Slides ein paar Minuten lang die neuesten Erkenntnisse vorzustellen, die mitunter in jahrelanger Kleinarbeit gewonnen wurden. Und nie genug Muße, um wirklich Feedback zu erhalten und sich womöglich mit kritischen Einwänden auseinanderzusetzen.
Letztere gibt es ohnehin an derlei Veranstaltungen kaum noch. Sie werden stattdessen im „double blind peer review“, also in einem anonymen Begutachtungsverfahren, geäußert – von zwei oder drei Forscherkollegen, die anhand eines Manuskriptentwurfs über die Präsentationschance auf der Tagung anschließend auch über die Publikation der Forschungsarbeit in einem wissenschaftlichen Journal oder über die Vergabe neuer Forschungsgelder entscheiden. Auch auf diese Weise ist programmiert, dass außerhalb der Forschergemeinde kaum jemand zur Kenntnis nimmt, was mit Millionen an Steuergeldern erforscht wurde und ob es in irgendeiner Weise Nutzen stiften könnte.
Schirrmachers Erbe
Es gab in Deutschland vor geraumer Zeit einen Zeitungsherausgeber, der das anders handhabte: Frank Schirrmacher. Der früh verstorbene Blattmacher der FAZ hat mit Leidenschaft dafür gesorgt, dass die digitale Disruption in seiner Zeitung immer wieder stattfand – mit überwiegend US-amerikanischen Autoren, die er würdigte und deren Beiträge er übersetzen ließ.
Damit hat Schirrmacher allerdings auch einen heiklen Trend verstärkt: Was prominente angelsächsische Forscherkollegen zu sagen haben, erhält in deutschsprachigen Medien oft einen Aufmerksamkeitsbonus. Wenn sich Internet-Gurus und US-Journalismusforscher wie Jeff Jarvis und Jay Rosen äußern, haben sie per se den Verdacht der Bedeutsamkeit auf ihrer Seite. Da spielt es dann keine Rolle mehr, wenn kurz oder auch längere Zeit zuvor Forscher aus Europa sich bereits ähnlich geäußert haben.
Vor ein paar Jahren präsidierte in der Schweiz Klaus Schönbach – einer der renommiertesten Kommunikationsforscher in Europa, der seinerzeit an der Universität Amsterdam lehrte – eine Evaluierungskommission, welche die Entwicklungsperspektiven für das Fach eruieren sollte. Schönbach predigte damals, die Kommunikationswissenschaft müsse sich dringend internationalisieren.
Die Präsenz der Schweizer Forscher jüngst bei der weltweit größten Jahrestagung der International Communication Association (ICA) in Washington zeigt eindrucksvoll, dass dies gelungen ist. Im Blick auf die Fachentwicklung gilt es allerdings auch, eine Besorgnis zu teilen, die Schönbach erst kürzlich geäußert hat: „Mussten wir unser Feld wirklich so weit über die ‚öffentlich gemeinte‘ Kommunikation hinaus ausdehnen? Das Kommunikationsverhalten von Stab und Linie in Organisationen untersuchen, die Arzt-Patienten-Kommunikation oder Konfliktlösungsstrategien von Ehepaaren?“ Und das „ausgerechnet in einem Zeitalter“, so Schönbach weiter, in dem es gerade an Themen zur öffentlichen Kommunikation als Untersuchungsgegenstand „so wenig mangelt wie nie zuvor“.
Im Rückblick hätte das Fach beim Diskurs um die Digitalisierung und Medienentwicklung in der Schweiz und in Europa womöglich ein ganz anderes Gewicht, wenn sich die Ausweitung seiner Schrebergarten-Kultur in alle Himmelsrichtungen hätte verhindern lassen.
Erstveröffentlichung: NZZ vom 27. Juli 2019
Bildquelle: pixabay.de
- 33Shares
- Facebook32
- LinkedIn1
- Buffer
Schlagwörter:Digitalisierung, Englisch, European Communication Research and Education Association (Ecrea), International Communication Association (ICA), Kommunikationswissenschaft, öffentliche Kommunikation, Schweiz, Wissenschaftskommunikation