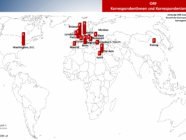Die Journalistin Lena Christin Ohm hat während eines einwöchigen Begegnungsprojekts des Maximilian-Kolbe-Werkes den Umgang von Kollegen mit Überlebenden des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau beobachtet. Die Eindrücke in Auschwitz und die Berichterstattung rund um die Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag der Befreiung des Lagers haben bei ihr viele Fragen aufgeworfen. Wie sollten Journalisten mit den Überlebenden umgehen? Wie können Medien angemessen über die Schicksale berichten? Was kann und muss man dem Publikum zumuten? Ihre persönlichen Eindrücke reflektiert sie in einem Plädoyer für eine nachhaltigere Erinnerungskultur in den Medien.
Ein alter Mann steht im Obergeschoss von Block 5 in Auschwitz, dem Stammlager des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Vor ihm stehen eine Kamera und ein Scheinwerfer, hinter ihm türmen sich die Koffer der in den Gaskammern brutal ermordeten Menschen. Und genau an diesem Ort soll der alte Mann, ein Überlebender der Hölle von Auschwitz, beschreiben, wie es sich anfühlt, zurück an den Ort des Grauens gekommen zu sein. Immer wieder fragt die Journalistin, wie er sich fühle. Er findet keine Worte dafür, spricht zusammenhangslos und schlurft durch den Raum. Auf die sich wiederholende Frage der Reporterin reagiert er nicht – dieser Ort scheint bei ihm zu viele Gefühle und Erinnerungen wachzurufen.
Diese Szene hat sich dieses Jahr genauso in Auschwitz abgespielt. Ich war selbst mit einer Gruppe junger Journalisten aus Deutschland, Österreich, Russland und der Ukraine dort. Wir waren eine Woche lange mit Vertretern des Maximilian-Kolbe-Werks, das sich um die Überlebenden der Ghettos und Konzentrationslager kümmert, in Oświęcim und haben dort zusammen mit Auschwitz-Überlebenden die Gedenkstätte und die offizielle Gedenkveranstaltung am 27. Januar besucht. In dieser Woche wurde ich Zeugin davon, wie manche Journalisten die hochbetagten Überlebenden behandeln. Das hat bei mir Fragen über den Umgang mit diesen alten, traumatisierten Menschen aufgeworfen. Warum hat sich diese Journalistin beispielsweise dazu entschieden, den Überlebenden in einer Baracke in Auschwitz zu interviewen? Wieso fotografieren Journalisten Überlebende in ihren schwächsten, verletzlichsten und persönlichsten Momenten? Beispielsweise wenn sie weinend eine einzelne Rose an der „Schwarzen Wand“ niederlegen, an der die Erschießungen stattfanden. Wie rechtfertigen sie das vor ihrem Gewissen? Sie würden Teresa Enke ja auch nicht um ein Interview an den Bahngleisen bitten, an denen ihr Mann gestorben ist. Warum ist es dann legitim und von manchen Redaktionen sogar verlangt, einen Auschwitz-Überlebenden für ein Interview vor den persönlichen Gegenständen der Ermordeten zu positionieren? Etwa weil das Trauma schon 70 Jahre her ist? Warum versucht ein anderer Journalist, ein Opfer von Mengeles Zwillingsversuchen zu überreden, mit ihm für ein Interview in den Block 10 zu gehen, in dem diese Frau als Kind durch die Menschenversuche der SS-Ärzte unbeschreibliche Qualen durchlitten hat? Wegen der Gefühle, die dieser Ort in den Menschen wachruft und deren Zeuge der Zuschauer werden soll, um das Gesagte besser nachvollziehen zu können?
Die Überlebenden erinnern sich auch so, fühlen auch so, ohne wieder an dem Ort ihrer Leiden zu sein. „Es ist alles noch ganz frisch in meinen Erinnerungen und während ich euch dies erzähle, erlebe ich alles noch einmal. Es bringt mich zurück an die Orte, erinnert mich an die Namen genauso wie an den Schmerz und die Sehnsucht nach den geliebten Menschen, die hier umgebracht wurden“, beschreibt Halina Birenbaum, die als Jugendliche von Warschau erst ins KZ Majdanek und später nach Auschwitz deportiert wurde. Sie steht vor dem für die Gedenkfeier golden beleuchteten „Tor des Todes“ in Birkenau, das symbolisch als Eingang zur Hölle und für den Massenmord an den Juden steht. Roman Kent wacht nachts schreiend und schweißgebadet auf. Weil er Alpträume von Auschwitz hat. „Selbst 70 Jahre später sind die tägliche Grausamkeit und das unmenschliche Verhalten im Lager immer noch in mein Gedächtnis eingebrannt. Der genießerische Ausdruck in den Gesichtern der Mörder und ihr Lachen während sie unschuldige Männer, Frauen und Kinder folterten, sind unbeschreiblich und hallen in meinem Bewusstsein nach. Wie kann jemand den Anblick von Menschen aus Haut und Knochen, lebende Skelette, je vergessen? Wie den alles überlagernden Geruch von verbranntem Menschenfleisch?“, fragt er. Reichen diese detaillierten Beschreibungen der Erinnerungen für sich allein nicht aus, um das Grauen von Auschwitz für das Publikum greifbar zu machen? Können die um die 90 Jahre alten Überlebenden dabei nicht wenigstens in einem der warmen, neutralen Räume der Gedenkstätte sitzen? Warum muss man sie ausgerechnet an die Orte zerren, mit denen sie die schlimmsten Erinnerungen verbinden oder an denen die letzten Überreste und Habseligkeiten der Ermordeten ausgestellt sind? Die Psychotherapeutin und Trauma-Expertin Fee Rojas warnt Journalisten davor, Gespräche mit traumatisierten Menschen am Ort des Geschehens zu führen, weil es die Interviewpartner zusätzlich belaste. Sie sollten besser einen geschützten Ort für das Interview auswählen. Im besten Fall sogar den Interviewpartner entscheiden lassen, wo und wann das Interview geführt werden solle. Und Fragen à la „Wie fühlen Sie sich gerade?“, wie sie die französische TV-Journalistin in Block 5 benutzt hat, grenzen laut Psychologe Thomas Weber bei vielen Betroffenen an Körperverletzung. All diese Informationen und empfohlenen Verhaltensweisen sind schon länger bekannt, spätestens seit dem Amoklauf in Winnenden sollten sie auch in den meisten deutschen Redaktionen – zumindest ansatzweise – angekommen sein.
Dr. Leon Weintraub ist mit seiner Frau Evamaria und unserer Journalisten-Gruppe in Birkenau, er fotografiert wie ein ganz normaler Besucher der Gedenkstätte. Dabei ist dies der Ort, an dem die Nazis seine Mutter und seine Tante ermordet haben. Und dem er nur mit Glück lebend entkommen ist. Am nachgebauten Wagon an der „Judenrampe“ in Birkenau fängt er an zu erzählen – von sich aus. Niemand hat ihn gefragt, niemand hat ihn gedrängt. Es war seine Entscheidung, an diesem Ort über seine Ankunft im Lager und die letzten Momente mit seiner Familie zu sprechen. Er macht es freiwillig, er macht es für sich genauso wie für uns Zuhörer. Als wir zu den Krematorien im Wald gehen sollen, schüttelt er den Kopf und bleibt mit seiner Frau zurück, um auf uns zu warten. Er hat die Grenzen gesetzt. Trotz journalistischer Neugier respektieren wir sie und gehen ohne ihn.
Warum fällt es anscheinend manchen Journalisten sogar in Auschwitz so schwer, Grenzen zu respektieren oder sie von sich aus zum Wohle des Gesprächspartners zu ziehen? Der alte Mann im Raum mit den Koffern hat dem Interview zugestimmt, er hat also zumindest geahnt, was die Reporterin wollte. Aber er hat wahrscheinlich nicht gewusst, was dieser Ort in ihm auslöst. Deshalb sollten Journalisten immer auch an das Wohlergehen ihrer Gesprächspartner denken. Und nicht nur an das perfekte Bild und den besten Ton. Denn während sie nach einem Dreh, einem Interview, wieder in ihr Leben zurückkehren können, bleiben die Interviewpartner gefangen in ihren Erinnerungen, die der Ort und die Fragen des Journalisten wieder an die Oberfläche gezerrt haben. Ich habe viele Auschwitz-Überlebende nach solchen Interviews beim Abendessen beobachtet: Der Blick ging ins Leere, sie haben an den Gesprächen um sie herum nicht teilgenommen. Um nicht rücksichts- und gedankenlos mit den Bedürfnissen der traumatisierten Menschen umzugehen, rät die Psychotherapeutin Fee Rojas unter anderem dazu, vorher ein Stopp-Zeichen zu vereinbaren, damit der Interviewte ein Gefühl der Kontrolle über das Gespräch bekommt. Außerdem sollten Journalisten ihre Protagonisten aktiv werden lassen, denn die Passivität erinnert sie an ihre hilflose Opferrolle.
Es wird immer auch Leser und Zuschauer geben, die die historischen Aufnahmen, die schrecklichen Details, kalt lassen. Einer dieser Menschen hat unter Anja Reschkes Tagesschau-Kommentar, in dem sie sich gegen einen Schlussstrich unter den Holocaust ausspricht, geschrieben, dass er ihr nicht glaubt, dass sie die Aufnahmen aus den Konzentrationslagern nicht haben schlafen lassen. Schließlich seien sie doch schon so oft gezeigt worden, da sei doch nichts dabei. Die Bedürfnisse solcher Menschen, die sich von diesen Bildern nicht berühren lassen und die immer mehr Gewalt und Grausamkeit sehen wollen, um wenigstens irgendetwas Vergleichbares wie Mitgefühl zu empfinden, möchte ich als Journalistin nicht bedienen. Aber denken wirklich viele Menschen im Publikum so? Wollen sie wirklich immer mehr und krassere Bilder sehen, um wieder etwas zu fühlen? Das ist theoretisch möglich, aber anhand der Praxis nicht ausreichend belegt. Die Habitualisierungstheorie besagt, dass Menschen bei ständiger Konfrontation mit fiktiver Mediengewalt abstumpfen und auch reale Gewalt als nicht mehr so dramatisch wahrnehmen. Das liege am Anpassungsmechanismus, der verhindere, dass Menschen auf ein und denselben Reiz immer wieder mit einer gleichhohen Emotionalität reagieren. Ihr zufolge seien Teile des Publikums durch Hollywood-Filme und grausame Propaganda-Videos Gewalt gewöhnt und bereits abgestumpft. Da erregt ein alter Mann in einem unauffälligen Büro keine emotionale Reaktion mehr. Ist der Glaube an diese Theorie der Grund dafür, dass der alte Mann in Auschwitz vor den Koffern, einem vielgenutzten Symbol für den Massenmord der Nationalsozialisten, stehen muss?
Selbst nach dem rücksichtsvollsten Interview, muss man das Gehörte in Worte fassen. Ich hatte große Schwierigkeiten damit. Und trotzdem wollte ich dem Menschen gerecht werden, der mir so tiefe Einblicke in sein Leben und sein Leiden gegeben hat. Wenn man von solch unvorstellbarem Grauen berichtet, zieht man das Publikum in ein tiefes Loch. Man schubst es in einen Abgrund. Und, weil das kein schöner Ort ist, um dort dauerhaft zu verweilen, soll dem Publikum am Ende ein Seil gereicht werden, mit dem es sich wieder aus dem Loch befreien kann. Denn mit der Trauer, der Einsamkeit, der Wut und der Grausamkeit, die die Erinnerungen an die Zeit im Konzentrationslager wachrufen, sollte man besser nicht enden, wurde mir vor ein paar Jahren von einem Kollegen gesagt. Das ließe das Publikum deprimiert und desillusioniert zurück, dabei hat der ehemalige Gefangene doch überlebt. Die Darstellung ungerechter Gewalt, wie sie gegen KZ-Häftlinge ausgeübt wurde, mache dem Publikum Angst, heißt es in einer Einführung in die Wirkung von Gewaltdarstellungen. Dahingegen falle es dem Publikum leichter sich mit dem Protagonisten zu identifizieren und ihn als Vorbild zu nehmen, wenn gerechtfertigte Gegenwehrdargestellt werde. Aber deshalb gleich ein positives Ende als Zeichen der gelungen Gegenwehr? Ausgelöschte Familien, gestohlene Jahre, Narben und Alpträume – das haben Überlebende wie Halina Birenbaum, Leon Weintraub und Roman Kent aus Auschwitz-Birkenau mitgenommen. Warum soll das Publikum nach der Lektüre dieser Geschichten, dieser Schicksale, sich nicht schlecht fühlen dürfen? Warum ist es schlimm, wenn ihnen ein Kloß im Hals das Atmen schwer macht? In Auschwitz-Birkenau und all den anderen Konzentrations- und Vernichtungslagern sind unvorstellbare Grausamkeiten geschehen. Da kann man es dem Publikum doch zumuten, sich einen Beitrag, einen Artikel, lang deswegen schlecht zu fühlen. Auch in unserer Wohlfühlkultur.
Der 27. Januar wurde zum Gedenktag für die Opfer des Holocaust, damit sie nicht vergessen werden. Und jede Geschichte, die in einer Zeitung erscheint, jeder Radio- und auch jeder Fernsehbeitrag, trägt zum Gedenken bei. Die Menschen, die die Nazis entmenschlicht haben und zu Nummern machen wollten, bekommen dadurch wieder einen Namen. Eine Geschichte. Deshalb stellen sich auch so viele Überlebende den Journalisten: Um denjenigen ihre Stimme zu geben, die nicht mehr sprechen können. Und damit diese Stimme von vielen gehört wird. Journalisten haben somit eine ehrenvolle Aufgabe. Nur sind sie leider häufig zu sehr in ihrem „Journalisten-Denken“ und in ihren redaktionellen Abläufen gefangen, als dass sie deren Bedeutung auf sich wirken lassen könnten. Der Gedenktag ist zur Routine geworden: Man veröffentlicht ein Portrait eines Überlebenden, berichtet über die offizielle Gedenkfeier und schließt danach in vielen Fällen die Akte bis zum nächsten Jahr. Denn die Lebensgeschichte eines Holocaust-Überlebenden hat bei vielen – wenn auch nicht bei allen Redaktionen – vor allem in den Tagen um den Gedenktag herum Konjunktur – das haben Kollegen von mir erfahren, die ihre Portraits über Auschwitz-Überlebende erst einige Zeit nach dem 27. Januar anboten. In diesem Zeitraum Ende Januar bis Anfang Februar werden die Bürger mit Beiträgen überflutet: Allein das Fernseh- und Radio-Programm der ARD sendet auf allen Kanälen und oft sogar zeitgleich Beiträge zum Thema Holocaust. Das kann das Publikum schon aus Zeitgründen gar nicht alles sehen oder hören, von der emotionalen Aufnahmefähigkeit ganz zu schweigen. Deshalb ist es keine Form des Erinnerns, die in die Zukunft wirkt. Es ist also an der Zeit zu reflektieren, was man den immer älter und gebrechlicher werdenden Überlebenden in Zukunft überhaupt noch ruhigen Gewissens zumuten sollte. Und spätestens, wenn die letzten Zeitzeugen gestorben sind, brauchen die Redaktionen für den 27. Januar einen neuen Plan. Besser also, man überlegt sich jetzt schon etwas Neues.
Bevor ich nach Auschwitz kam, habe ich gedacht, dass ich mich vielleicht schämen würde. Weil ich schließlich Deutsche bin. Als ich Auschwitz verlassen habe, habe ich mich tatsächlich geschämt. Aber nicht nur, weil ich Deutsche bin. Sondern auch weil ich Journalistin bin.
Bildquelle: Lena Christin Ohm
Schlagwörter:Auschwitz, Berichterstattung, Gedenken, Jahrestag, Medienethik, Umgang mit Opfern