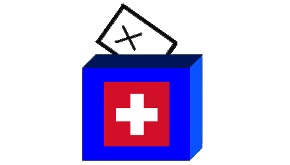Weltwoche 23 /2008
Heute preisen wir einen grossen Verleger. Weil er ein grosser Verleger ist, hält er zum Ärger der Journalisten nichts von innerer Pressefreiheit. ie Zeitungen sind am Sterben, sagt man uns. Wir müssen es wohl glauben, weil uns selbst Zeitungsverleger sagen, die Zeitungen seien am Sterben. Wenn wir sie über die Zukunft ihrer Zeitungen befragen, dann antworten sie uns: «Online first.»
Wir wollen darum einmal ein Loblied auf jenen Mann singen, der wie kein Zweiter an die Zukunft der Zeitungen glaubt: Rupert Murdoch.
Soeben ging seine gigantische Druckerei in Broxbourne in Betrieb, zwanzig Kilometer vor London. Broxbourne ist, hinter Terminal 5 in Heathrow, der zweitgrösste Industriebau in der Geschichte Grossbritanniens. Englische Kommentatoren fragten sich, ob Murdoch noch zurechnungsfähig sei, so viel Geld in eine sterbende Zunft einzuschiessen.
175 Zeitungen besitzt Murdoch bereits. Die letzte, das Wall Street Journal, hat er vor einem halben Jahr für 5,6 Milliarden Dollar gekauft. Seitdem ist das WSJ noch besser geworden, noch kompakter und verdichteter.
Damit sind wir beim entscheidenden Punkt. Rupert Murdoch glaubt an die Zukunft der Zeitung, weil er weiss, wie die Zeitung der Zukunft aussehen muss. Die Zeitung der Zukunft entwickelt sich aus dem Konzept, dass die Leser wenig Zeit zum Zeitunglesen haben. Die Artikel müssen darum möglichst reich an Information und möglichst arm an Zeilenlänge sein.
«Lange recherchieren – kurz schreiben», lautet sinngemäss Murdochs Devise. Chefredaktoren, die Langatmiges und Beliebiges in ihren Blättern dulden, schmeisst der Patron sofort raus. Zuletzt traf es den schweizstämmigen Chefredaktor Marcus Brauchli beim Wall Street Journal.
Die meisten Journalisten mögen Murdoch nicht. Die meisten Journalisten mögen Verleger nicht, die etwas von ihrem Geschäft ver-stehen. Sie bevorzugen an der Spitze Schönredner und Grüssauguste, die sie in Ruhe lassen. Sie wollen keine Einmischung des Besitzers in ihr Blatt.
Aus diesem Grunde setzten die Journalisten vielerorts die «innere Pressefreiheit» durch. Sie unterscheidet sich von der äusseren Pressefreiheit nur durch die Definition des Gefahrenherds.
Die äussere Pressefreiheit entstand Ende des 18. Jahrhunderts. Sie sollte die Zeitungen vor der Allmacht des Staates schützen. Die innere Pressefreiheit entstand 150 Jahre später. Sie sollte die Zeitungen vor der Allmacht des Verlegers schützen.
Vor allem die 68er versuchten, die innere Pressefreiheit rigoros zu verankern. Die Alt-68er tun das heute noch. Der Besitzer einer Zeitung, so ihre Meinung, soll gefälligst die Klappe halten. Was in der Zeitung steht, entscheidet die Allmacht der Journalisten.
Darum sind Verleger wie Murdoch so unbeliebt. Sie geben die politische und publizistische Ausrichtung selber vor. Wer nicht spurt, fliegt. Hier unterscheidet sich Murdoch auch von manchen Schweizer Verlegern, denen bei der Lektüre der eigenen Blätter oft hilflos die Haare zu Berge stehen.
Die angeschlagene Zeitungsbranche braucht Verleger wie Murdoch. Er hat schon aus der modrigen Times eine Spitzenzeitung geformt. Seine Sun ist die erfolgreichste Boulevardzeitung der Welt, die News of the World sind das knalligste Krawallblatt dieses Planeten. Auch das hochklassige Wall Street Journal hat er noch hochklassiger gemacht, indem er mehr politische Themen durchsetzte.
Ich habe vor einiger Zeit einen Schweizer Verleger getroffen. Er regte sich darüber auf, was für ein erfolgloses Blatt seine Journalisten produzierten. Was er nun tue, fragte ich ihn. Er gehe nun in die Ferien, sagte der Verleger.