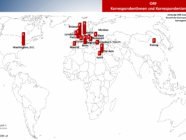- 28Shares
- Facebook28
- Buffer
Im Medienjournalismus sind die herrschenden Verhältnisse die Verhältnisse der Herrschenden.

Unverfänglich – wie der aktuelle Spiegel-Beitrag über Modejournalismus – soll Medienjournalismus nach Ansicht der Verlage sein.
Vor fünf Wochen stellte der Spiegel seinen Medienteil ein. „Texte aus der vielfältigen Welt der Medien“, so versicherte das Blatt, „finden unsere Leser künftig an entsprechend vielen Orten im Heft.“
An den entsprechend vielen Orten im Heft erschienen seitdem gerade zwei Artikel zum Thema, einer über Modejournalismus und einer über Sat1.
Auch das Schweizer Fernsehen gab auf. Vor gut zwei Jahren lancierte es seinen „Medienclub“. Es sollte eine kritische Talkrunde werden, weil „die Medien immer wieder selbst Anlass zu Diskussionen geben“.
Nach nur vier Ausgaben schlief die Sendung ein. Nun kündete SRF einen Zweitstart an. Franz Fischlin von der „Tagesschau“ wird Moderator. Ein zweites Scheitern wäre nicht überraschend.
Medienjournalismus ist in den Medienhäusern die unbeliebteste Disziplin des Journalismus. Die tägliche Mediennutzung von Radio, TV, Internet und Presse liegt zwar heute bei acht Stunden. Doch über die Akteure dieser acht Stunden erfahren wir fast nichts.
Vor sieben Jahren verschwand die letzte tägliche Medienseite des Landes, jene der Aargauer Zeitung. Seitdem gibt es in der Tagespresse an ständigen Gefäßen nur noch die wöchentliche Medienseite in der NZZ.
Der Grund für das Desinteresse ist simple Ökonomie. Karl Marx würde es so formulieren: „Im Medienjournalismus sind die herrschenden Verhältnisse die Verhältnisse der Herrschenden.“
Das Mediengeschäft ist enorm konzentriert. Nur noch vier große Schweizer Verlagshäuser kontrollieren den privaten Markt: Ringier, Tamedia, die NZZ-Gruppe und die AZ Medien. Kommerziell arbeiten sie oft eng zusammen. Ihre Journalisten können darum nicht kritisch über andere Verlage schreiben, ohne das Business des eigenen Hauses zu tangieren. Das aber ist unerwünscht.
Medienjournalismus ist stets ein internes Risiko für externe Geschäftsbeziehungen.
Exemplarisch zeigt sich dieses Dilemma beim Medienteil der NZZ. Die Redaktion verzichtet völlig auf recherchierte Storys und Hintergründe zu den anderen Großverlagen wie Tamedia, Ringier und AZ-Mediengruppe. Die Gefahr für Konflikte ist offenbar zu groß. Stattdessen schreibt die Medienseite lieber über unverfängliche Themen, zuletzt etwa über türkische Comics, über britische Radios und über Schwulenmagazine in Uganda.
In Deutschland ist es noch ein bisschen anders. Die Marktteilnehmer sind weniger verfilzt. Große Zeitungen wie Süddeutsche, FAZ und Tagesspiegel leisten sich noch eine tägliche Medienseite.
Aber auch in Deutschland wachsen Druck und Nervosität in der Branche. Die Medienredaktion des Spiegels etwa sorgte immer wieder für Unmut bei hauseigenen Geschäftspartnern wie Bertelsmann, Axel Springer und RTL. Das Problem könnte mit dem Ende des Medienteils nun gelöst sein.
Bei uns war man noch schneller. Schon im Jahr 2002 schaffte der Tages-Anzeiger seinen mehrseitigen Medienbund ab. Seit längerem plant das Blatt, nun wieder einen regelmäßigen Medienteil einzuführen.
Ist das eine gute Idee? Im Jahr 2002 konnte die Medienredaktion des Tages-Anzeigers noch unbeschwert über die ganze Branche schreiben. Seitdem hat ihr Tamedia-Verlag die Berner Zeitung übernommen, den gesamten Westschweizer Pressemarkt aufgekauft, ist Medienmonopolist in Winterthur und Zürichs Landschaft geworden, macht den digitalen Auftritt der Basler Zeitung, hat gemeinsame Online-Firmen mit Ringier aufgebaut, ist Partner der Swisscom und druckt die NZZ.
Ich rate dem Tages-Anzeiger dringend ab, einen Medienteil einzuführen. Das gibt nur Ärger.
Erstveröffentlichung: Weltwoche vom 23. Juli 2015, S.25
Bildquelle: Der Spiegel/Screenshot
- 28Shares
- Facebook28
- Buffer
Schlagwörter:Deutschland, Medienjournalismus, Medienkonzentration, Schweiz