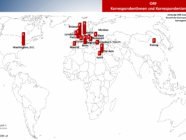Erstveröffentlichung: Message 03/04
Zwischen Konkurrenzschelte und Selbstbeweihräucherung
Eine aktuelle Studie zeigt: Schweizer Medienjournalisten sehen sich als Liebesdiener, allenfalls als Chronisten, mit Medienkritik tun sie sich entsprechend schwer.
Dem Journalismus in der Schweiz werden gerne hohe Qualitätsstandards und Kontinuität, bis hin zu einer gewissen Behäbigkeit, bescheinigt. Von Kontinuität ist ausgerechnet im Medienjournalismus derzeit wenig zu spüren. Reihenweise werden Medienressorts aufgelöst: Ob die «Weltwoche», der «Tages-Anzeiger», der «Bund» oder das Nachrichtenmagazin «Facts» – alle können plötzlich auf ihre Medienseiten verzichten.
Auch die Zahl der Printmedien insgesamt geht zurück. Die Schweizer Medienunternehmen verflechten sich immer mehr, der Mediensektor wird intransparenter. Unter solchen Bedingungen, so vermutete schon vor Jahren der Kommunikationswissenschaftler Stephan Russ-Mohl, liegt es nahe, dass in der Medienberichterstattung wirtschaftliche Eigeninteressen der Medienhäuser stärker durchschlagen, als dies wünschenswert ist. Die Versuchung müsse gross sein, so Russ-Mohl, Selbstbeweihräucherung, sowie Cross-Promotion für Medienprodukte aus dem eigenen Haus zu betreiben, und andererseits Konkurrenten je nach Lage der Dinge totzuschweigen oder anzuschwärzen.
Ob solche Tendenzen in der Medienberichterstattung in der Deutschschweiz tatsächlich empirisch beobachtbar sind, untersuchte der Verfasser in einer Lizentiatsarbeit an der Università della Svizzera italiana in Lugano. Im Folgenden sollen die wichtigsten Ergebnisse vorgestellt werden. Sie beziehen sich auf drei exemplarische Fälle, die als «Case Studies» inhaltsanalytisch untersucht wurden.
Erster Fall: «Die Weltwoche»
Beim ersten Fall handelt es sich um den Relaunch der «Weltwoche», der im Mai 2002 erfolgte. Eigentlich nichts Unübliches, doch dass eine Wochenzeitung das Format wechselt und sich obendrein politisch umpositioniert (vom linksliberalen ins rechte Lager), dabei aber zugleich auch provokant und unberechenbar wird, ist in der Schweizer Medienlandschaft ein bislang einzigartiger Vorgang. Dem Formatwechsel bei der «Weltwoche» ging darüber hinaus eine bewegte Phase von Verkaufsverhandlungen des Mutterkonzerns, der Basler Mediengruppe («Basler Zeitung»), voraus. Der Relaunch konnte deshalb nur mit Verzögerung realisiert werden.
Zweiter Fall: «Der Bund»
Im Sommer 2003 kam es zu Verhandlungen um die älteste Berner Tageszeitung «Der Bund». Das Blatt schrieb seit Jahren nur noch rote Zahlen. Das veranlasste die NZZ-Gruppe, die 80 Prozent an der Bund Verlag AG hielt, mit anderen Medienunternehmen Gespräche über eine mögliche Beteiligung zu führen. Den Zuschlag bekam schliesslich die Espace Media Groupe, Mehrheitsaktionärin der auf dem Berner Medienmarkt konkurrierenden «Berner Zeitung». Damit kam es zum «Berner Modell» – einer in der Schweiz bisher einmaligen Konstruktion, bei der ein und dasselbe Medienunternehmen Anteile an konkurrierenden Zeitungen hält.
Dritter Fall: Die «NZZ am Sonntag»
Gegen Ende des Jahres 2003 sorgte die «NZZ am Sonntag» für Aufsehen: Lorenz Wolffers, ein in den USA beheimateter Schweizer Journalist, hatte das Schwesterblatt der renommierten «Neuen Zürcher Zeitung» mit gefälschten Artikeln beliefert. Als der Schwindel aufflog, trat die «NZZ am Sonntag» die Flucht nach vorn an, führte eine Selbstanalyse durch und veröffentlichte die Ergebnisse im eigenen Blatt.
Die Analyse der Medienberichterstattung über diese drei Fälle soll Erkenntnisse über die journalistische Selbst- und Fremddarstellung in Schweizer Printmedien liefern.
Ausuferndes Lob
Schon der erste Fall zeigt, dass sich auch Qualitätszeitungen mit der Berichterstattung übers eigene Haus schwer tun: Der redaktionelle Raum wird als «Werbefläche» für die Eigenvermarktung missbraucht. Bei der Selbstberichterstattung werden negative Aspekte, die das eigene Haus oder die eigene Redaktion betreffen, meist ausgeklammert.
Die «Weltwoche» übertrieb dabei: Im Vergleich zu anderen Publikationen verfasste die Redaktion fast doppelt so viele Beiträge über die Bilanz des Formatwechsels. Stolz wurden neue Auflagen- und Verkaufszahlen veröffentlicht, Berichte anderer Medien zitiert und gewonnene Preise verkündet.
Immerhin zeigte die Zeitung ein gewisses Bewusstsein für die Problematik des Publizierens in eigener Sache. Sie packte fast alle Beiträge in ihre Editorials, an einen Platz also, der für «Kundgebungen» der Redaktion durchaus vorgesehen ist. Trotzdem ist der Hang zur Selbstpromotion klar feststellbar: Positive Meldungen stehen im Vordergrund, Pressemitteilungen des Hauses werden recyclet, das Editorial verkommt so zu einem Raum für Eigenvermarktung, getreu dem Satz: «Wes Brot ich ess‘, des Lied ich sing’».
Fälschungen – Einzelfälle?
Mit der «NZZ am Sonntag» berichtete ein Schweizer Printmedium erstmals über das Versagen in einem Skandal, in den es selbst verwickelt war. Die Selbstthematisierung mag per se anerkennenswert sein, sie blieb jedoch an der Oberfläche der Ereignisse kleben. Wie die Fälschungen von Lorenz Wolffers letztendlich ins redaktionelle Angebot gelangten, wurde nicht eruiert. Tatbestände wurden zwar rekonstruiert, aber als Ausnahmeerscheinung klassifiziert. Dass der Fall auch Ausdruck des Versagens interner Kontrollmechanismen war, wurde nicht in Betracht gezogen. Ein blinder Fleck in der Berichterstattung blieb somit bestehen, der Vorfall wurde elegant gelöst: «Schuld» war eine Einzelperson, der Fälscher.
Auch die Berichterstattung der Konkurrenz rekonstruiert in diesem Fall nur die Tatbestände und begrenzt die Kritik ebenfalls auf den Fälscher. Man neigt dazu, die Schuld lieber einem einzelnen «Täter» anzulasten, um von der redaktionellen Verantwortung abzulenken – statt zuzugeben, dass ein ähnliches Desaster auch anderen Redaktionen widerfahren könnte.
Berichterstattung über die Konkurrenz
Aus der inhaltsanalytischen Untersuchung geht gleichwohl hervor, dass in allen drei Fällen die Berichterstattung über Konkurrenten mit 52 Prozent einen besonders hohen Anteil an meinungsbetonten Aussagen aufweist. Insgesamt überwiegen mit 27 Prozent dabei klar die negativen Aussagen im Verhältnis zu den positiven (14 Prozent) oder ambivalenten (11 Prozent). Die These, dass bei der Konkurrenz Negatives aufgebauscht wird, beim eigenen Unternehmen Kritisches dagegen unter den Teppich gekehrt wird, scheint sich somit zu bestätigen.
Direkte Konkurrenten werden dabei in allen Fällen mit einer höheren Anzahl negativer Aussagen bedacht. Dies zeigt sich vor allem in der Berichterstattung des Nachrichtenmagazins «Facts» über das Konkurrenzblatt «Weltwoche». Bei Häusern, die nicht in unmittelbarem Wettbewerb zueinander stehen, fallen die Ergebnisse dagegen unterschiedlich aus. Bestes Beispiel hierfür ist die «Aargauer Zeitung», die durchwegs kritisch über alle ausgewählten Fälle berichtet.
Synergie-Effekte
Wenige grosse Konzerne wie Ringier, Edipresse, Tamedia, die NZZ-Gruppe oder die Espace Media Groupe dominieren das Schweizer Mediengeschäft. Die Versuchung, bei der Berichterstattung über Produkte oder Projekte des eigenen Konzerns ausserhalb der eigenen Redaktion Cross-Promotion zu betreiben, ist gross. Denn so lassen sich positive Synergie-Effekte erzielen, die sich vielleicht umsatzsteigernd auswirken. Die Arbeit der Medienjournalisten gerät zu einer Gratwanderung: Unternehmergeist und Unternehmensinteressen konfligieren mit dem Ziel unabhängiger Berichterstattung, vorauseilender Gehorsam mit Bereitschaft zu journalistischer Kritik und Selbstkritik.
Immerhin werden in der Schweiz Eigeninteressen und Konzernverflechtungen in der Medienberichterstattung grösstenteils offen gelegt. Trotzdem werden die Medienredaktionen häufig als Werbeinstrument missbraucht. Eklatantes Beispiel ist die «Berner Zeitung» in der Diskussion rund um das «Berner Modell». Mit 43 Aussagen berichtet die «Berner Zeitung» allein so viel Positives über das Vorhaben, wie alle anderen untersuchten Printmedien zusammen: Der Gipfel ist eine ganzseitige Rede der Konzernleitung, ohne Begleitkommentar; sie liest sich wie eine PR-Meldung.
Beschönigende Effekte sind auch zu erwarten, wenn durch non-reporting die Berichterstattung über Pannen des eigenen Medienhauses ausgespart wird. Dies war bei der Berichterstattung der «Neuen Zürcher Zeitung» über die Wolffers-Affäre des Schwesterblattes «NZZ am Sonntag» der Fall: Ein mögliches Versagen der internen Kontrollmassnahmen wurde eben auch vom Mutterblatt nicht in Betracht gezogen.
Chronistenpflicht vs. Medienkritik
In allen drei untersuchten Fällen agierten Medienjournalisten nicht als Medienkritiker, sondern sahen ihre Hauptaufgabe darin, der Chronistenpflicht nachzukommen. Sie beschränkten sich in ihrer Berichterstattung überwiegend auf nachrichtliche Faktoren, während Kritik nur eine sekundäre Rolle spielte. Dies kann aus der äusserst geringen Anzahl an Kommentaren geschlossen werden und wurde auch in den persönlichen Interviews bestätigt.
Hackt also eine Krähe der anderen kein Auge aus, wie so oft von Kritikern des Medienjournalismus vermutet wird? Das trifft nur bedingt zu: Als Nachrichten «getarnte» Artikel sind häufig unterschwellig mit Kritik gespickt. Medienjournalisten kritisieren auf sehr subtile Weise.
Keine erfreulichen Aussichten
Welche Folgen hat es, wenn Printmedien auf eigene Medienseiten verzichten? Würden Medien und Journalismus als Querschnittsthemen mit der selben Sorgfalt behandelt, wie wenn es eigenen reservierten Platz dafür gibt, wäre das kein Problem. Publikationen, die der Medienberichterstattung eigene Seiten widmen, berichteten jedoch häufiger über die Medienwelt. Die «Aargauer Zeitung», die als einzige über eine tägliche Medienseite verfügt, veröffentlichte die meisten Artikel (durchschnittlich 14) über die analysierten Fälle – deutlich mehr als Zeitungen ohne Medienseite, wie beispielsweise der «Tages-Anzeiger» oder die «Berner Zeitung» (beide durchschnittlich neun Artikel).
Die Bilanz ist ernüchternd. Gleichwohl darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass es – wie das Beispiel «NZZ am Sonntag» zeigt – im Schweizer Medienjournalismus durchaus Ansätze zu kritischer Selbstreflexion gibt. Und wenn bei Medienthemen wirtschaftliche Eigeninteressen im Spiel sind, wird das häufiger als erwartet offen gelegt. Auch die «Weltwoche» zeigt, dass ein Bewusstsein für Selbstberichterstattung vorhanden ist, wenn sie Meldungen in eigener Sache in den Editorials und nicht im Nachrichtenteil publiziert.
Unabdingbare Voraussetzung für einen kompetenten, glaubwürdigen Medienjournalismus ist eine eigene Medienredaktion, die gegenüber der Verlagsleitung und der hauseigenen PR-Abteilung möglichst unabhängig sein sollte. Diese Bedingung ist nur in wenigen Redaktionen erfüllt. Ohne einen öffentlichen Diskurs über Journalismus ist es nämlich kaum möglich, im Publikum, aber auch in den Köpfen der Journalisten selbst, Qualitätsbewusstsein zu verankern. Auch in der Schweiz muss weiter Überzeugungsarbeit geleistet werden. Die Leser haben Anspruch darauf, sich über Medien und Journalismus genauso selbstverständlich informieren zu können wie über Politik, Wirtschaft und Sport.
Die wissenschaftliche Methode
Im Zeitraum vom 1. September 2001 bis zum 30. November 2003 wurden acht Printmedien («Berner Zeitung», «Aargauer Zeitung», «NZZ», «NZZ am Sonntag», «St. Galler Tagblatt», «Tages-Anzeiger», «Facts» und «Weltwoche») untersucht. Mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse analysierte der Autor 244 Artikel. Diese bezogen sich ausdrücklich und klar erkennbar auf die drei im Text erwähnten Fälle. Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse wurden in Gesprächen mit mehreren Medienredakteuren erörtert, um weiterführende Informationen zu erhalten und die Interpretation der empirischen Befunde zu erleichtern.
Schlagwörter:Chronistenpflicht, Medienkritik, Qualität, Schweiz, Synergie-Effekte