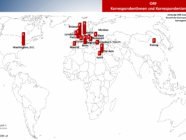Manchmal sagt eine Idee viel aus über den aktuellen Zustand einer Zunft. Diesmal war es eine Idee aus der Medienbranche.
Die St. Galler Medienprofessorin Miriam Meckel übernahm für eine Woche die Chefredaktion des Zürcher Tages-Anzeigers. Nach einer Woche und sechs Nummern kam sie zur Erkenntnis, der redaktionelle Alltag sei ein „langer, unruhiger Fluss“. Mag sein. Bemerkenswert an der Idee ist zuerst jedoch die Botschaft, die sie nach außen sendet. Jeder zufällige Dilettant, so die Botschaft, kann heute als Chefredakteur eine große Zeitung leiten.
Halt. Das war politisch nicht korrekt formuliert. Korrekt formuliert, muss es heißen: Jeder zufällige Dilettant und jede zufällige Dilettantin können heute als Chefredakteur und als Chefredakteurin eine große Zeitung leiten. Stimmt diese Botschaft? Man kann dazu die Qualität der sechs Ausgaben unter Professorin Meckel betrachten. Es kam, wie es zu erwarten war. Das Blatt war nicht schlechter und nicht besser als sonst. Es gab, wie immer, ein paar gelungene Artikel und Kommentare, es gab, wie immer, ein paar lausige Artikel und Kommentare. Neunzig Prozent, wie immer, waren solides Mittelmaß.
Courant normal. Insofern ist der Befund wenig überraschend. Man hätte anstelle von Miriam Meckel auch Marie-Theres Nadig oder Michelle Hunziker delegieren können. Es wäre nicht viel anderes passiert. Redaktionen von größeren Tageszeitungen sind heute erprobte und eingespielte Produktionsstätten der Informationsverpackung. Sie sind stark bürokratisiert. Kreativität in der Ablaufregie ist nicht erwünscht. Über eine Vielzahl von Verwaltungsfunktionen wie Nachrichtenchefs, Blattmacher, Produzenten und Ressortleiter wird der industrielle Fertigungsprozess strukturiert und abgesichert. Im Redaktionsalltag braucht es keinen Häuptling, der seinen Indianern sagt, was sie zu tun haben.
Wenn in Deutschland Wahlen sind, braucht es keinen Chefredaktor, der seinen Leuten sagt, man müsse nun über Angela Merkel schreiben. Wenn das Schweizer Fußballteam gewinnt, braucht es keinen Chefredakteur, der seinen Leuten sagt, man müsse nun über Ottmar Hitzfeld schreiben. Das können die jederzeit auch so. Wozu braucht es also den Chef? Es braucht ihn, um permanent die Identität seines Blatts zu schärfen. Eine Zeitung ist wie eine Persönlichkeit. Sie braucht ein klares Profil, einen eindeutigen Charakter, eine unverwechselbare Linie. Linie und Profil entstehen durch die Themen, auf die man setzt. Letztlich ist der Job eines Chefredakteurs ein politischer Job.
Es gibt nicht viele in der Mediengeschichte, die das wirklich exemplarisch hinbekommen haben. In den achtziger Jahren war das sicher Peter Uebersax. Er wandelte den Blick von der leichten Sex-and-Crime-Postille zur relevanten, konservativen Plattform. In den neunziger Jahren war es Roger de Weck. Er wollte aus dem biederen Regionalblatt Tages-Anzeiger ein weltmännisches Forum der gehobenen Debattierkultur machen.
Unter den heutigen Chefredaktoren gibt es nur ganz wenige, etwa bei der Neuen Zürcher Zeitung oder der Basler Zeitung, die noch solch stilprägende Ambitionen haben. Die Mehrheit unserer Schriftführer hat keine gesellschaftspolitischen Vorstellungen mehr, die sich journalistisch niederschlagen sollen. Sie sehen sich eher als emotionslose Lieferanten für Inhalte aller Art.
Maßstab ist die möglichst professionelle Versorgung des Publikums mit digitalen wie gedruckten News. So betrachtet, war die Botschaft rund um Miriam Meckel gar nicht so falsch. Man kann als Chefredakteur und Chefredakteurin heute wirklich fast jeden und jede nehmen.
Erstveröffentlichung: Die Weltwoche Nr. 43 / 2013
Bildquelle: re:publica 2013 / Flickr CC (Original ohne Schriftzug)
Schlagwörter:Chefredakteur, Chefredaktion, Miriam Meckel, Peter Uebersax, Redaktion, Roger de Weck, Schweiz, Sesseltausch, Tages-Anzeiger