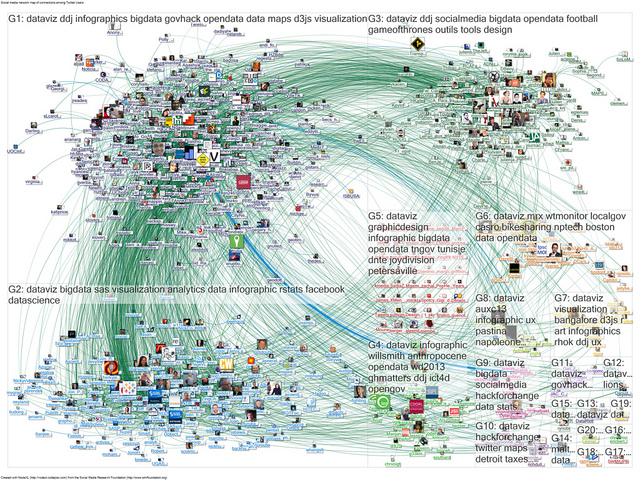Besucher blicken am 08.05.2017 auf der re:publica (#rp17) in Berlin durch VR-Brillen. Foto: re:publica/Gregor Fischer ( CC BY-SA 2.0)
Innerhalb der immersiven Nachrichtenberichterstattung wird die lineare Berichterstattung durch eine dreidimensionale Darstellung journalistischer Geschehnisse ersetzt, bei der die Rezipient:innen ihre Perspektive eigenständig bestimmen können. Aynur Sarısakaloğlu (TU Ilmenau) und Irina Böttcher (Universität der Bundeswehr München) geben in ihrem Fachartikel „Virtuelle Realität und Journalismus“ einen Überblick über die Anwendung, Potenziale und Risiken von VR im Journalismus. Darüber hinaus diskutieren sie theoretische Anknüpfungspunkte sowie ethische Herausforderungen.
Virtual Reality wird schon lange nicht mehr nur im Unterhaltungs- und Bildungsbereich eingesetzt. Seit einigen Jahren gewinnt die immersive Technologie auch im Journalismus zunehmend an Bedeutung. Im Gegensatz zu anderen Technologien, wie beispielsweise künstlicher Intelligenz, erfolgt die Einführung von VR allerdings langsamer. So zeigt eine Studie des Reuters Institute, dass nur acht von 246 Medienschaffenden bereit sind, in den Bereich Virtual Reality zu investieren. Das Forschungsfeld ist dementsprechend noch jung und wurde bislang nur teilweise erschlossen.
(Bisherige) Einsatzfelder von Virtual Reality in der Berichterstattung
Ziel des VR-Journalismus ist es, die Distanz zwischen den Rezipient:innen und den Geschehnissen, über die berichtet wird, weiter zu verringern. Dieser Ansatz ist nicht neu. Beispielsweise wird auch innerhalb des narrativen Journalismus versucht, eine engere Beziehung zwischen den Rezipient:innen und dem Beschriebenen herzustellen. Durch die Verschiebung in den virtuellen Raum können die Ereignisse aber anders wahrgenommen werden, die Rezipient:innen beispielweise ihre eigene Perspektive auswählen. Bisher wird zwischen zwei Darstellungsweisen unterschieden. Während 360-Grad-Videos vorgegebene Perspektiven und Handlungen mit eingeschränkten Interaktionsmöglichkeiten und Präsenzgefühlen aufweisen, ermöglichen volumetrische Produktionen bereits einen höheren Grad an Immersion ohne begrenzte Bewegungsfreiheit und mit Interaktionsmöglichkeiten. Obwohl letztere mehr Möglichkeiten bieten, dominiert bisher die Verwendung von 360-Grad-Videos den VR-Journalismus.
Volumetrische Produktionen unterscheiden sich von 360-Grad-Videos in der Art, wie sie den Raum erfassen und dem Zuschauer zugänglich machen:
- 360-Grad-Videos bieten eine sphärische Perspektive, in der der Zuschauer zwar in alle Richtungen blicken kann, sich aber an einem festen Punkt innerhalb der Szene befindet. Man kann nicht um Objekte oder Personen herumgehen, sondern nur die Blickrichtung ändern.
- Volumetrische Produktionen hingegen erfassen eine Szene dreidimensional. Dadurch kann sich der Zuschauer frei um die gefilmten Personen oder Objekte bewegen, als wären sie echte 3D-Modelle. Dies bedeutet eine viel tiefere Interaktivität, da nicht nur die Blickrichtung, sondern auch die Perspektive innerhalb der Szene frei gewählt werden kann.
In der Praxis werden diese Formate bereits aktiv von Medienunternehmen wie der New York Times, Euronews oder CNN angeboten. Letztere verfügen sogar über eine „eigene VR Abteilung“. Im deutschsprachigen Raum haben zum Beispiel das ZDF und die Süddeutsche Zeitung erste Versuche in der Virtual Reality Berichterstattung unternommen, um den Rezipient:innen ein hautnahes Erlebens eines virtuell nachgestellten journalistischen Geschehens zu ermöglichen. Bisherige Analysen zeigen, dass VR-Nachrichten bisher vor allem in den „aktuelle[n] Themen, investigative[n| Journalismus und [der] Hintergundberichterstattung“ sowie in der Berichterstattung über „Kultur und Wissenschaft“ eingesetzt werden.
Potenziale des VR-Journalismus
Dadurch, dass die Rezipient:innen zu Protagonist:innen werden, besteht die Möglichkeit, dass diese die „Ereignisse besser durchdringen, voreingenommene Haltungen ausblenden und eigenständig Schlüsse aus narrativen Handlungen ziehen können“. Des Weiteren kann die bereits angesprochene „räumliche, zeitliche und soziale Distanz[…]“ überwunden beziehungsweise Nähe durch die Teilhabe an der immersiven Berichterstattung erzeugt werden. Außerdem könnten dadurch die emotionale Verbundenheit und Empathie der Rezipient:innen gesteigert werden. Darüber hinaus wurde bereits bewiesen, dass narrative Darstellungsformen „den Wissenswachstum und das Erinnerungsvermögen steigern können“.
Ein oft angebrachtes Beispiel ist das von der amerikanischen Journalistin Nonny de la Peña konzipierte „Project Syria“, in dem sie „Schauplätze des syrischen Bürgerkriegs“, unter anderem eine „virtuell rekonstruierte Realität einer Bombenexplosion in Aleppo“ nahbar macht.
VR-Journalismus fordert Neuorientierung in der Nachrichtenproduktion
Durch die Verschiebung der Berichterstattung in den virtuellen Raum, ergeben sich verschiedene Herausforderungen. Eine der größten ist dabei eine nötige Neuorientierung in der Nachrichtenproduktion. Während der Journalismus durch die soziale Medien schon seine Gatekeeper-Funktion verloren hat, verlieren Journalist:innen im VR-Journalismus zum großen Teil auch ihre Erzähler:innen-Funktion.
Auch für die Rezipient:innen können sich neben den positiven, auch negative Effekte beim Konsum von immersiver Berichterstattung ergeben. So kann die Rezeption eines 360-Grad-Videos über ein Headset die Aufmerksamkeit sowie die Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen beeinträchtigen.“ Zudem kann die Bereitstellung multimodaler Inhalte „die Fähigkeit der Rezipient:innen, auditive, visuelle und haptische Reize adäquat wahrzunehmen und zu verarbeiten, überfordern und damit die Aufnahmefähigkeit für die Hauptinformation verringern.“ Außerdem können 360-Grad-Videos als Desorientierung und Ablenkung wahrgenommen werden.
Weiterentwicklung der Journalismusforschung notwendig
Auch wenn Virtual Reality den Journalismus nicht grundlegend verändert, so beeinflusst diese doch die Art und Weise, wie journalistische Inhalte kommuniziert und rezipiert werden können. Daraus ergeben sich neue Herausforderungen, mit denen sich die Forschung in Zukunft auseinandersetzen muss.
Traditionelle Ansätze der Journalismusforschung müssen weitergedacht werden und eine vernetzungs- und technikorientierte Perspektive stärker berücksichtigt werden. So haben Adriana Paíno Ambrosio und Isabel Rodrígurz Fidalgo (Universität Salamanca) bereits 2021 begonnen, ein erstes „Modell für immersive Kommunikation“ zu entwickeln. Im Gegensatz zu den Kommunikationsmodellen mit Kodierung und Dekodierung durch Sender und Empfänger, werden diese Aspekte im VR-Journalismus eigenständig durch die Technologie bestimmt. „Dafür sind die Produktion und Rezeption von immersiven Inhalten an entsprechende Software und Hardware gebunden, die erforderlich sind, um Nachrichten in einer virtuellen Umgebung empfangen und dekodieren zu können.“ Außerdem kann der:die Rezipient:in das Feedback neben den Absender:innen auch „an die Nachricht selbst schicken.“ Erlebt der:die Rezipient:in die Berichterstattung mit weiteren Usern, ist auch Feedback in Richtung dieser möglich. Infolgedessen schlagen die Forscher:innen ein Modell für die Struktur immersiver journalistischer Nachrichten vor. Als Grundlage dienen dafür die klassischen W-Fragen der nachrichtlichen Berichterstattung. Das Modell kann als Basis „für die Recherche und immersive Berichterstattung“ verwendet werden. Das „Wo?“ entspricht demnach nicht mehr einem realen Ort des Geschehens, sondern einem virtuellen Ort. Ähnlich ändert sich das „Wann?“ auf den Moment, in dem die Rezipient:innen VR-Inhalte mittels visueller Endgeräte wahrnehmen.
Außerdem müsse laut Sarısakaloğlu und Tribusean die Nachrichtenwerttheorie bezüglich immersiver Nachrichten angepasst werden. In der Berichterstattung besteht kein physischer Ort mehr, wobei die Geschehnisse besser nachempfunden werden könnten. Deshalb erlangen gerade den Faktoren Nähe, Zeit und Dynamik eine besondere Bedeutsamkeit. Darüber hinaus müsse man „Qualitätskriterien wie Objektivität, Transparenz oder Glaubwürdigkeit neu oder anders fassen“. Die Glaubwürdigkeit der VR-Berichterstattung wird zwar durch das „Präsenzgefühl“ gesteigert. Allerdings gilt dies auch für Falschinformationen. Zudem sollten in der Forschung „werte- und kodexorientierte Qualitätskriterien“ erarbeitet werden.
Ethische Verantwortung
Aufgrund des Präsenzgefühls und die vor allem emotional ansprechenden Gestaltung im VR-Journalismus, ist laut den Wissenschaftlerinnen eine kritische Auseinandersetzung mit dem Genre nötig. Denn die Rezipient:innen können gegebenenfalls an für sie bisher wahrscheinlich unerreichbare Orte gelangen und neue Perspektiven erleben. Dadurch steigt allerdings die Gefahr, dass die Rezipient:innen keine hinreichende Distanz zum journalistischen Inhalt entwickeln. Unter anderem können durch die „Intensität des virtuellen Erlebens und die emotionale Involvierung Ängste bei den Rezipient:innen ausgelöst werden. Aufgrund dessen bedarf es einer Überprüfung, ob beispielsweise „die Leiderfahrungen von Kriegsopfern, zu einer Verharmlosung oder Trivialisierung von Ereignissen beitragen, wenn Rezipient:innen für kurze Zeit in die gleiche Situation versetzt werden.“ Zudem sollten bestehenden Ethikkodices auf den Umgang mit Virtual Reality im Journalismus überprüft werden beziehungsweise um dessen erweitert werden. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf einen gewissenhaften Umgang mit sensiblen Daten, die Wahrung der Persönlichkeitsrechte der simulierten Protagonistinnen sowie die Integrität der Bilder geachtet werden.
Mit Blick auf die Zukunft sollte laut den Wissenschaftlerinnen, gerade im Bereich der theoretischen Anknüpfungspunkte sowie ethischen Folgen, mehr Forschung betrieben und der bereits diskutierte Perspektivwechsel aufgenommen werden. Inwiefern immersive Technologien den Redaktionsalltag und die damit verbundene Wertschöpfungskette ändern, bleibt unklar.
Quellen:
Sarısakaloğlu, A. & Böttcher, I. (2024). Virtuelle Realität und Journalismus. In: M. Löffelholz und L. Rothenberger (Hrsg.), Handbuch Journalismustheorien (S. 427-426). Springer VS.
Newmann, N. (2022). Journalism, media, and technology trends and predications 2022. Reuters Institute für the Study of Journalism.
Paíno Ambrosio, A & Rodríguez Fiadlgo, M. I. (2021). Proposal for a new communication model in immersive journalism. Journalism, 22(10), 26000-2617.
Schlagwörter:Digitaler Wandel, Ethik, Innovation, Redaktion, Technik, Virtual Reality, VR-Journalismus