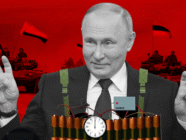Dieses Bild wurde von der Autorin mithilfe von ChatGPT erstellt.
In Russland ist erneut von umfassenden Internetblockaden und dem Aufbau eines „digitalen Gulags“ die Rede – einer totalen Kontroll- und Überwachungsstruktur nach chinesischem Vorbild. Den Startschuss für die jüngste Kampagne gab Wladimir Putin persönlich, als er dazu aufrief, ausländische Digitalplattformen, die in Russland noch immer weit verbreitet sind, zu „erdrosseln“: Dazu zählen unter anderem Dienste der in Russland als „extremistisch“ eingestuften Meta-Gruppe wie WhatsApp und Instagram, aber auch Wikipedia, Googles Angebote von Gmail bis YouTube – und nicht zuletzt Telegram. Das Ziel scheint klar: Der Weg soll frei werden für Russlands neue Super-App – VK MAX.
MAX ist eine neue digitale Plattform, die im März 2025 von VK gelauncht wurde – Russlands größtem sozialen Netzwerk, das unter starkem politischem Einfluss steht. Die Idee: MAX soll zur digitalen Schnittstelle zwischen Bürger:innen und Staat werden. Öffentliche Dienstleistungen, Kommunikation mit Behörden und Identitätsnachweise – etwa bei Hotelbuchungen, Flugtickets oder dem Kauf von Alkohol – sollen über die App laufen. Auch Bildungseinrichtungen und Schulchats sollen integriert werden. Zudem ist vorgesehen, dass MAX auf allen in Russland verkauften Geräten vorinstalliert wird – was bedeutet, dass Nutzer:innen, insbesondere weniger technikaffine Menschen, kaum um die App herumkommen und sie oft automatisch als Hauptkanal für digitale Kommunikation und Behördenkontakte verwenden dürften.
MAX folgt dabei einem klaren Vorbild: Chinas Allzweck-App WeChat, die für alltägliche Aufgaben genutzt wird – und zugleich als effektives Instrument staatlicher Überwachung gilt. Der Kreml will diesen Ansatz übernehmen und MAX zur zentralen Plattform im Verhältnis zwischen Staat und Individuum machen. Ist die Lage also wirklich so dramatisch? Spoiler: ja – aber nicht ganz so, wie man denkt.
Die Strategie des Kremls
Bevor man über die ambitionierten Pläne spricht, einen multifunktionalen Dienst zu schaffen, der den nationalen Messenger mit einem digitalen ID-System verbindet, lohnt sich ein Blick zurück: Im September 2024 kündigte die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor an, rund 59 Milliarden Rubel (über 600 Millionen Euro) in die Modernisierung der nationalen Infrastruktur zur Blockierung von Internetdiensten zu investieren.
Die politische Motivation hinter solchen Investitionen liegt offen zutage. Der politische Wendepunkt kam mit den Massenprotesten im Winter und Frühjahr 2011/2012 gegen manipulierte Wahlen zur Staatsduma und zum Präsidentenamt, die Wladimir Putin zurück an die Macht brachten. Spätestens seitdem gilt das Internet im Kreml nicht nur als Mobilisierungsplattform, sondern auch als Einfallstor für ausländischen Einfluss – eine doppelte Bedrohung, der mit wachsender Regulierung begegnet wurde. Seitdem wird konsequent – wenn auch mit wechselndem Erfolg – versucht, den digitalen Raum unter Kontrolle zu bringen: mit dem ersten Sperrgesetz, mit einer eigenen Suchmaschine namens „Sputnik“ (als russisches Pendant zu chinesischem Baidu gedacht, aber nie durchgesetzt), sowie mit einer Reihe von Gesetzen, die es den Sicherheitsbehörden de facto ermöglichen, auf Kommunikationsinhalte, Dateien und jede Form von Nutzeraktivität innerhalb russischer Plattformen zuzugreifen.
Das erklärte Fernziel war und ist, ein geschlossenes Internet nach chinesischem Vorbild zu schaffen – ein digitaler Raum, der nicht nur vollständig nationalisiert ist, sondern in dem das Regime in Echtzeit auf Inhalte, inklusive privater Kommunikation, zugreifen kann. Im Maximalfall: eine digitale Parallelwelt, vollständig entkoppelt vom globalen Netz.
Erste Reaktionen der Nutzer:innen: “Funktioniert sogar auf dem Parkplatz!”
Während der Staat an einer abgeschotteten digitalen Parallelwelt arbeitet, erleben viele Nutzer:innen im Alltag ein anderes Bild: regelmäßige Internetausfälle, gestörte Geodienste – und Anfang Juli ein massives Flugchaos mit über 2.000 gestrichenen oder verspäteten Flügen. In Städten wie Sankt Petersburg kam es zeitgleich zu Netzstörungen, die selbst bargeldlose Zahlungen lahmlegten. Solche Ereignisse verstärken das Gefühl eines allgemeinen Kontrollverlusts und technischer Unsicherheit. Vor diesem Hintergrund wirkt die Influencer-Kampagne für den neuen Messenger MAX – der „immer funktioniert“ – wie ein bewusst gesetztes Signal: Hier herrscht noch Stabilität.
Influencer betonen, dass die App „sogar auf dem Parkplatz, im Fahrstuhl und unterwegs funktioniert“ – also für Funktionen, die man eigentlich voraussetzt. Das Internet reagierte prompt mit Spott: Memes, Parodien und Kommentare machten deutlich, wie surreal es ist, dass funktionierendes Netz heute als Innovation verkauft wird.
Mehr als Politik: ein digitaler Megakonzern
Doch es gibt nicht nur politische, sondern auch wirtschaftliche Interessen hinter der aktuellen Dynamik. Eine zentrale Rolle spielt hierbei das Management von VK – angeführt von Wladimir Kirijenko, Sohn von Sergej Kirijenko, dem für Innenpolitik und den Runet zuständigen Vizechef der Präsidialverwaltung. Unter seiner Leitung wird offen für die Schaffung eines staatlich gestützten Internetmonopolisten geworben. Die Vision: eine “Plattform-Korporation”, die sämtliche digitalen Massenangebote vereint – Video-Streaming, Messaging, Musik, Zahlungsdienste, E-Commerce und Online-Bildung. Eine Plattform, die nicht nur 90 Prozent der digitalen Nutzerbedürfnisse abdeckt, sondern vor allem sämtliche staatlichen Internetbudgets an sich zieht – Gelder, die bisher auf verschiedene Anbieter verteilt waren: von Propagandamitteln über Digitalisierungsprojekte bis hin zu Technologien zur Nutzerüberwachung.
Ziel ist es, einen Dienst zu schaffen, der aus staatlicher Sicht alles leisten kann: Nutzer:innen in Propagandaprogramme leiten, in Echtzeit Nachrichtenverläufe, Zahlungen, Einkäufe und View-History einsehen, gezielte Inhalte pushen oder Personen digital „ausradieren“. Wer öffentlichkeitswirksam agiert – etwa als Musiker:in mit regierungskritischem Interview –, muss damit rechnen, dass der Weg vom „ausländischen Agenten“ zum „Extremisten“ kurz ist. In einer Realität, in der ein solcher Dienst als einzig verfügbarer Zugang zum Netz fungiert, lässt sich nicht nur Musik, sondern auch der Name eines Menschen mit einem Klick aus der Plattform löschen. VK steht hier für ein weitreichendes Konzept: die schrittweise Transformation des Internets in ein staatlich kontrolliertes Informationssystem – in dem Inhalte nicht frei zirkulieren, sondern wie im klassischen Fernsehen zentral produziert, ausgewählt und gelenkt werden.
Doch dieses Konzept funktioniert nur im Zusammenspiel mit wachsendem Druck auf konkurrierende Plattformen. Die bisherigen Erfahrungen mit „Sputnik“, der staatlichen Wikipedia-Alternative, und dem VK-Messenger zeigen: Ohne Einschränkungen für beliebte Dienste wie Telegram wechseln Nutzer:innen nicht freiwillig. Vor diesem Hintergrund erscheinen auch die aktuellen Ankündigungen strengerer Sanktionen gegen Telegram als Teil einer Strategie, alternative Angebote schrittweise zurückzudrängen – zugunsten eines zentralisierten, staatlich kontrollierten Ökosystems.
Große Pläne, wacklige Realität
Anfang Juni veröffentlichte das Investigativmedium iStories eine Recherche über die mutmaßlich engen Verbindungen zwischen Telegram und dem FSB. Da der Servercode von Telegram nicht öffentlich ist, bleibt nur, Telegram-Gründer Pawel Durow beim Wort zu nehmen – er versichert weiterhin, dass sein Unternehmen keinen Kontakt zu den Sicherheitsdiensten habe.
Auf die technischen Details dieser Debatte wollen wir hier nicht eingehen, weil es für den Gesamtzusammenhang nicht entscheidend ist. Unabhängig davon jedoch, wie stark der Druck des russischen Staates auf Telegram auch sein mag – im globalen Maßstab bleibt der Dienst dem Regime gegenüber feindlich eingestellt. Neben YouTube ist Telegram die wichtigste Plattform für unabhängige Exilmedien.
Wie groß die Kontrolle des russischen Staates über Telegram auch sein mag – sie reicht ihm nicht aus. Selbst wenn Durow unter Druck gesetzt werden kann, bestimmte Inhalte zu löschen oder zu sperren, erfordert das jedes Mal Aufwand: Es muss verhandelt oder mit härteren Sanktionen gedroht werden. Das ist nicht vergleichbar mit einem direkten Zugriff auf das Admin-Panel eines sozialen Netzwerks wie VK – von jedem Rechner eines Geheimdienstmitarbeiters aus. Ähnlich sieht es bei privaten Chats in Telegram aus. Es ist eher unwahrscheinlich, dass der FSB direkten Zugriff auf ein persönliches Konto hat – zumindest nicht mit Unterstützung von Telegram selbst. Andererseits: Wer als Journalist:in, Menschenrechtler:in oder Aktivist:in für die russischen Behörden von Interesse ist, sollte vertrauliche Gespräche auf Telegram besser vermeiden.
Ein staatlich kontrollierter nationaler Messenger wäre da eine ganz andere Größenordnung. Wenn Nachrichtenlage, Unterhaltung, private Kommunikation und Konsumverhalten der Nutzer:innen in einer einzigen Hand gebündelt sind, entsteht eine Dimension der gesellschaftlichen Kontrolle, die sich mit punktuellen Druck auf externe Plattformen nicht vergleichen lässt. Die derzeitige Entwicklung von VK zeigt deutlich die Ambition, das gesamte Internet in einen einzigen staatlichen Dienst zu verwandeln: Auf VK Video wird nur gezeigt, was das Regime freigegeben hat. Der VK-Marketplace bietet Produkte staatsnaher Anbieter. Und die Charts von VK Music bestehen aus Künstler:innen, die dem Regime als loyal gelten.
Und hier lohnt es sich, an den entscheidenden Unterschied zwischen Fernsehen und Internet zu erinnern. Das Internet ist so aufgebaut, dass es für jeden anders aussieht. Wenn wir unseren „eigenen“ Internetraum beschreiben, erzählen wir dabei auch etwas über uns selbst – wie in einem Spiegel. Manche sehen darin eine wissenschaftliche Bibliothek, andere eine Arena politischer Debatten, für wieder andere ist es ein Heimkino. Das Internet wird von den Menschen gestaltet, die es nutzen. Das Fernsehen hingegen wird von jenen gemacht, die die Kanäle kontrollieren. In Russland kann das Fernsehen einen grauen, unbekannten Bürokraten zum Präsidenten und „Vater der Nation“ machen. Es kann das Publikum davon überzeugen, dass ein Thema, von dem es gerade zum ersten Mal hört, das größte Problem seines Lebens sei. Die meisten Fernsehstars sind Stars per Ernennung. Und jede Geschichte – so erfunden sie auch sein mag – wird durch ständige Wiederholung zur Realität, der man als Zuschauer kaum entkommen kann.
Das Ziel ist es also, das Internet vollständig zu entpolitisieren und zu entleeren. Nicht durch Blockaden, Strafverfolgung oder Zensur – sondern indem unliebsame Nachrichten gar nicht erst existieren. In der idealen Welt, auf die die Machthaber hinarbeiten, ist ein populärer Influencer keine persönliche Erfolgsgeschichte, kein Zeichen für Reichweite oder Resonanz. Es ist ein offizieller Status – eine Funktion, die man verleihen und wieder entziehen kann.
Das VK, wie es derzeit aufgebaut wird, ermöglicht eine Form der Kontrolle über den öffentlichen Raum, die mit Repressionen allein niemals zu erreichen wäre. Jede Verfolgung bekannter öffentlicher Persönlichkeiten schadet auch denjenigen, die sie ausüben. Ganz anders, wenn man eine Person mit einem Klick zum Verschwinden bringen kann. Nicht im Sinne des „Cancelns“ à la Twitter – sondern so, dass es im Internet so aussieht, als hätte diese Person als öffentliche Figur niemals existiert.
Zwischen Ideologie und Profit
So sollte das Ganze aus Sicht des russischen Staates eigentlich funktionieren: also ein kontrolliertes, abgeschlossenes Netz mit zentraler Steuerung aller Inhalte – das chinesische Internet in Reinform. Doch hier ist ein entscheidender Punkt zu beachten – man darf nicht verwechseln, was das Regime will und plant, mit dem, wozu es tatsächlich in der Lage ist.
Zur Erinnerung: Der Kampf des russischen Staates gegen das Internet dauert bereits seit 13 Jahren an. Und diesen utopischen Plan haben dem Staat in all diesen Jahren die unterschiedlichsten Medienmanager – mal größere, mal kleinere – verkauft. Bei jeder politischen Zuspitzung, angefangen mit den Protesten von 2011–2012, über die Krim bis hin zum heutigen Angriffskrieg gegen die Ukraine, bildet sich eine ganze Schlange von „Start-uppern“, die dem Staat in verschiedenen Formulierungen immer dasselbe versprechen: das Internet in ein Fernsehen zu verwandeln. Doch jedes dieser Gespräche beginnt stets mit einer Bedingung: Milliarden aus dem Staatshaushalt.
Die Geschichte von VK begann – gelinde gesagt – nicht erst gestern. Hartnäckige Gerüchte über eine mögliche YouTube-Blockade und groß angelegte Arbeiten an VK Video kursieren mindestens seit dem (noch) Vorkriegsjahr 2021. In dieser Zeit hat sich VK faktisch zum Monopolisten in der VPN-freien Content-Verbreitung entwickelt. Neben VK Video, das aus staatlicher Sicht eindeutig erfolgreicher ist als Rutube (der russische YouTube-Klon) und andere haushaltsfinanzierte Plattformen, hat VK mehr Geld in den Aufkauf von Content-Creators gesteckt als jemals zuvor ein Unternehmen auf dem russischen Markt. Laut The Bell zahlte VK bereits 2023 bis zu einer halben Milliarde Rubel (umgerechnet ca. 5 Millionen Euro) an Künstler:innen, damit sie ihre Shows auf der hauseigenen Videoplattform veröffentlichen. VK verpflichtete gezielt bekannte Creators – in der Hoffnung, dass sie ihr Publikum mitbringen.
Das war eigentlich ein wichtiges politisches Projekt – und ein komplett gescheitertes. Die ganze Idee bestand darin, YouTube rechtzeitig „den Kopf abzudrehen“ – und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es dort einfach nichts mehr zu sehen gibt. Letztlich nahmen die Influencer:innen das staatliche Geld dankend an und kehrten, kaum war der Vertrag ausgelaufen, mit großer Erleichterung zurück zu YouTube. Denn kein Geld der Welt kann fehlende Reichweite und klare Spielregeln ersetzen. Mit „klaren Spielregeln“ meinen Blogger:innen in der Regel funktionierende Empfehlungssysteme, transparente Zuschauerstatistiken und eine faire Monetarisierung – auf YouTube funktioniert das alles automatisiert und nachvollziehbar. Auf VK hingegen hängt vieles von manuellen Eingriffen ab und wirkt eher wie ein staatlich alimentiertes Fördersystem.
Selbst in Bezug auf einen Messenger startete VK nicht erst zu Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine einen neuen Versuch. VK erinnerte sich plötzlich daran, dass es ja noch ICQ besitzt – jenen Dienst, der einst absoluter Monopolist und Platzhirsch war. Durch jahrelanges Missmanagement verlor er zunehmend an Relevanz – nicht etwa wegen der Konkurrenz, sondern weil die Nutzung für viele schlicht nicht mehr sinnvoll war. Bei diesem zweiten Anlauf wurde ICQ einem Neudesign unterzogen, das Telegram bis ins letzte Pixel kopierte. Damals, im mittlerweile schon fernen Jahr 2022, war die Idee, ICQ zur Plattform zu machen, auf die der Staat alle Nutzer:innen der „feindlichen“ Messenger zwangsweise umlenken würde. Und das Ergebnis? Im Mai 2024 verkündete ICQ das Aus seiner Plattform lapidar per Hinweis auf der eigenen Website.
Klar ist: VK hat die Ambition, der Runet ganz allein zu sein. Und der Staat hat die Ambition, so ein Monstrum zu besitzen. Nur wird das bisher nicht als groß angelegte Staatsstrategie umgesetzt, sondern in erster Linie als altbekanntes Großprojekt zur Umverteilung von Haushaltsmitteln. Und dafür gibt es gute Gründe.
Erstens: Das russische Internet ist nicht das chinesische – weder technisch noch strukturell. Was dort zentral geplant und durchgesetzt wird, zerfällt hier im Kleinkrieg rivalisierender Akteure. Chinas Internet ist weitgehend vom Rest der Welt abgeschottet, es wurde von Anfang an um eine Handvoll Megaplattformen herum gebaut. Dabei halfen ein paar einfache Umstände: China ist riesig – ein Markt mit 1,5 Milliarden Menschen, auf dem ein in sich geschlossener Internetraum tatsächlich funktionieren kann. Und: Die Nutzer:innen kannten andere Dienste gar nicht – also suchten sie auch nicht danach.
Zweitens: Die Ambitionen des Staates und die des VK-Managements mögen nach außen hin gleich klingen – tatsächlich aber unterscheiden sie sich deutlich. Den Managern des Staatskonzerns geht es nicht um Ergebnisse. Sie beherrschen den Prozess. Der Kampf um ein „souveränes Internet“ macht sie fabulös reich. Es geht nicht darum, Profit zu erwirtschaften, sondern darum, sich an den Geldströmen festzuklammern. Und das gelingt ihnen ziemlich gut.
Drittens: Es gibt im russischen Internet keine Monopole. Es gibt viele Akteure, die ein Interesse daran haben, dass der russische Online-Raum wettbewerbsfähig bleibt – und dass kein einzelnes Monstrum alle anderen schluckt. Da ist zum Beispiel der einflussreiche Tech-Gigant Yandex mit seinem ganzen Ökosystem. Da sind große Marktplätze wie Ozon und Wildberries. Und letztlich gibt es viele, die sich ebenfalls an die Fördergelder des Importsubstitutions-Booms dranhängen wollen. Russland ist ein System aus unterschiedlichsten „Clans“ und Interessengruppen – alle wollen sie an die Staatskasse. Und das Wichtigste: Sie wollen nicht, dass die anderen Erfolg haben. Es gibt keine hierarchische Willensbildung, die sich wie eine Funkwelle von oben nach unten ausbreitet. Jene, die gigantische Summen in Telegram-Propaganda investieren, haben null Interesse an einem zentralisierten, monopolisierten Verbreitungsweg.Und wer dem Staat Rutube als russisches YouTube verkaufen will, hat kein Interesse an einem erfolgreichen Konkurrenzprojekt – schon gar nicht an VK Video. Und so weiter.
Genau deshalb reduziert sich der ganze Plan vom souveränen Internet – mit all seinen ausgeklügelten Ideen: westliche Plattformen verdrängen, Creator aufkaufen, den gesamten Traffic auf sich ziehen – am Ende auf banale Blockaden. Blockaden, die alle, die es wirklich wollen, einfach umgehen. Damit verfehlen sie ihren eigentlichen Zweck: die Kontrolle über Debatten und über die öffentliche Agenda.
Ja, das Internet ist ein natürlicher Feind autoritärer Regime. Und ja, die Zerschlagung des Netzes wird bis zum bitteren Ende betrieben. Aber: Das russische Internet wurde einst von sehr klugen Köpfen in Zeiten großer Freiheit aufgebaut. Und das System der russischen Staatsmacht, in dem der Kampf um Haushaltsgelder wichtiger ist als staatliche Zielerreichung, macht das Projekt eines vollständig kontrollierten, „chinesischen“ Internets in Russland illusorisch. Natürlich kann und wird man den Bürger:innen das Leben schwer machen – das Internet wird beschädigt. Aber um ein chinesisches Internet zu bauen, muss man auch bauen können – und das ist eine ganz andere Hausnummer.
Schlagwörter:Internet, Internetfreiheit, MAX, Russland