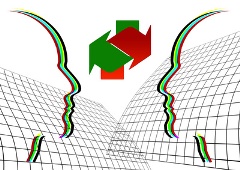Dieser Text ist Teil der PROMPT-Reihe.
Nach der Auflösung der Ampel-Koalition und inmitten eines angespannten politischen Klimas stand Deutschland 2025 vor einer richtungsweisenden Bundestagswahl. Der Wahlkampf wurde zunehmend von gezielten Desinformationskampagnen geprägt – oft verbreitet über soziale Medien, manchmal auch durch politische Akteure selbst. Welche Mechanismen stecken dahinter? Wie können Journalistinnen und Journalisten dagegenhalten? Und welche Verantwortung tragen Plattformen und Regulierungsbehörden?

Christina Elmer ist Professorin für Digitalen Journalismus und Datenjournalismus an der TU Dortmund, erfahrene Datenjournalistin sowie Co-Koordinatorin von GADMO (German Austrian Digital Media Observatory)
Christina Elmer, Professorin für Digitalen Journalismus und Datenjournalismus an der TU Dortmund, erfahrene Datenjournalistin sowie Co-Koordinatorin von GADMO (German Austrian Digital Media Observatory), analysiert im Interview die Herausforderungen der digitalen Informationslandschaft, die Wirksamkeit von Fact-Checking-Initiativen und die regulatorischen Bemühungen auf europäischer Ebene. Sie zeigt auf, wo es Fortschritte gibt – und wo Medien, Plattformen und Politik noch stärker gegensteuern müssten.
Merle van Berkum: Was ist deine allgemeine Einschätzung zur Informationslage vor der Bundestagswahl. Welche relevanten Entwicklungen siehst du hier?
Christina Elmer: Die Verbreitung von Falschinformationen zieht sich aktuell durch die gesamte politische Landschaft, so ist unser Eindruck. Gerade von politischen Akteuren würde man ja erwarten, dass sie wahrheitsgemäß und faktenbasiert kommunizieren, gerade in vorbereiteten Reden oder Statements. Aber offenbar scheint das nicht oder nicht mehr so zu sein, was ich persönlich sehr bedrückend finde. Wir beobachten immer wieder Fälle, in denen falsche oder irreführende Informationen gestreut werden, was letztlich die Glaubwürdigkeit untergräbt.
Vor der Bundestagswahl oder auch rund um die Bundestagswahl – das Thema ist ja noch lange nicht vorbei – hat man gemerkt, dass der öffentliche Diskurs im Netz immer wieder von Falschmeldungen beeinflusst wurde und auch von Desinformationskampagnen, die dann entsprechend eingeordnet werden konnten. Das waren einerseits Themen, die immer wieder vor demokratischen Wahlen zu beobachten sind, die beispielsweise die Integrität von Wahlen in Frage stellen. Dazu gehören Behauptungen, Briefwahlstimmen würden vernichtet oder Wahlurnen seien nicht richtig verschlossen gewesen. Hier konnten wir besonders von den Erfahrungen im europäischen Netzwerk EDMO profitieren und auf diese Themen präventiv hinweisen. Dann gab es aber auch gezielte Falschmeldungen bezogen auf einzelne Personen, insbesondere auf Robert Habeck und Friedrich Merz. Wir haben zudem Kampagnen gesehen, die aus Russland offensichtlich mitgesteuert wurden, etwa„Storm-1516“.
Wir stellen also auch eine versuchte Einflussnahme aus dem Ausland fest. Und was ich besonders beunruhigend finde, ist das wir Falschinformationen auch im politischen Diskurs selbst, im Parlament, in Talkshows und Statements sehen – von wo aus sie sich dann oftmals besonders schnell verbreiten.
Welche Hebel siehst du aus journalistischer Perspektive, um dem entgegenzuwirken?
Ein erster Ansatz wäre, das Vertrauen in die eigene Arbeit zu stärken und journalistische Arbeitsweisen und Methoden transparent zu machen. Es ist wichtig zu erklären, was Qualitätsberichterstattung von anderen Quellen unterscheidet. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, die Glaubwürdigkeit von Informationen richtig einzuschätzen. Daher sollte Berichterstattung nicht nur korrekt sein, sondern auch Medienkompetenzen vermitteln. Die Leserschaft sollte dafür sensibilisiert werden, wie Desinformation funktioniert, und dazu ermutigt werden, den eigenen Medienkonsum kritisch zu reflektieren. Besonders in emotional aufgeladenen Momenten, wenn man eine Nachricht impulsiv weiterverbreiten möchte, sollte man innehalten und die Quelle hinterfragen. Das wäre eine ganz konkrete Empfehlung, um zu verhindern, dass man in solchen Momenten selbst zur Verbreitung von Falschinformation beiträgt.
Solche Kompetenzen zu vermitteln, ist aus meiner Sicht aber nicht allein Aufgabe der Medien. Es wäre wünschenswert, dass bereits in Schulen eine stärkere Förderung von Medienkompetenz stattfindet. Wie wir aus der Forschung wissen, informieren sich junge Menschen zunehmend über soziale Medien, insbesondere über Plattformen wie TikTok, die sie ähnlich wie eine Suchmaschine nutzen. Die Herausforderungen ist also, wie man diese Zielgruppen am besten erreicht.
Wie hast du die Rolle der Plattformen vor der Bundestagswahl wahrgenommen? Gab es Regulierungen oder Bestrebungen, gegen Desinformation vorzugehen?
Es gab durchaus Bemühungen, die Integrität der Wahl zu schützen. Im Kontext der EU-Regulierungen wurden unterschiedliche Maßnahmen durchgeführt. Zum Beispiel organisierte die EU-Kommission ein sogenanntes Rapid-Response-System, an dem auch wir beteiligt waren. Dieses System ermöglichte es, besonders problematische Postings direkt an Ansprechpersonen der Plattformen zu melden. Die Reaktion erfolgte meist schnell, einige Postings wurden nach einer internen Prüfung gelöscht. In einigen Fällen wurde festgestellt, dass Beiträge nicht gegen Richtlinien verstoßen haben, aber dennoch in ihrer Sichtbarkeit eingeschränkt wurden, um eine massenhafte Verbreitung zu verhindern. Auch TikTok hat in solchen Fällen immer recht schnell reagiert. Es war sehr gut, diesen direkten Draht zu haben und Beiträge prüfen lassen zu können, die mit einem hohen Risiko verbunden waren.
Zusätzlich gab es auf europäischer und deutscher Ebene unterstützende Maßnahmen im Rahmen oder im Umfeld der Regulierung. Die Bundesnetzagentur führte beispielsweise einen Stresstest mit den Plattformen durch, um mögliche Szenarien zu analysieren und zu schauen, wie man diese verhindern oder ihnen jeweils begegnen kann. Dennoch bleibt viel Luft nach oben. Recherchen von Correctiv haben gezeigt, dass von normalen Nutzenden gemeldete Inhalte bei TikTok online blieben, ohne dass eine Reaktion erfolgt ist. Das zeigt, dass die aktuellen Mechanismen der Regulierung noch nicht ausreichend greifen. Aktuell befinden wir uns zudem in der Übergangsphase vom Code of Practice on Disinformation hin zu einem Code of Conduct, also von einer Selbstverpflichtung hin zu einem Verhaltenscodex innerhalb des Digital Services Act. In diesem Prozess sieht man schon jetzt Unterschiede auch zwischen den Plattformen, etwa zur Zusammenarbeit mit Faktencheckern oder zur Unterstützung von Forschenden. Also da gibt es durchaus Licht und Schatten. Mein Eindruck ist, dass es einfach ein Thema ist, was erst in dem Moment, wo es mit einem systematischen Risiko zu tun hat, wirklich von allen Akteuren ernst genommen wird.
Welche Rolle spielten Fact-Checking-Initiativen im Wahlkampf? Konnten sie gegen Desinformation wirksam vorgehen?
Wir können natürlich nicht exakt bemessen, inwieweit Fact-Checking einen Unterschied gemacht hat. Leider haben sich, wie schon gesagt, auch einige politische Akteure selbst an der Verbreitung von Fehlinformationen beteiligt. Besonders problematisch ist das dann, wenn solche Aussagen unkommentiert stehen bleiben und nicht mit Fakten ergänzt werden. In manchen Fällen haben Plattformen Desinformation sogar begünstigt, indem sie bestimmten Inhalten mehr Reichweite verschafft haben. Ein Beispiel dafür ist das Interview von Alice Weidel mit Elon Musk auf X, das eine große Bühne für potenziell irreführende Aussagen bot. Hier hätte den Verantwortlichen schon im Vorfeld klar sein müssen, dass dieses Format ein hohes Risiko für Falschinformationen birgt, die man hinterher nicht mehr einfangen und wirkungsvoll einordnen kann.
Wenn wir die aktuelle Entwicklung mit vergangenen Bundestagswahlen vergleichen: Hat sich das Problem von Desinformation verschärft?
Ja, den Eindruck habe ich. Ein Blick in andere Länder zeigt, dass es immer wieder Einflussnahmen auf Wahlen gibt. In Rumänien müssen die nationalen Wahlen aufgrund vermuteter Manipulationen im Bereich Desinformation sogar wiederholt werden. Forschungen zeigen, dass solche Kampagnen oftmals systematisch gesteuert sind. Besonders besorgniserregend ist, dass einige Plattformen ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Desinformation aktuell zurückfahren. In den USA will Meta etwa die Zusammenarbeit mit Fact-Checkern beenden und setzt stattdessen auf Community Notes. Dadurch bekommt das Thema der Qualitätskontrolle auch eine neue Dynamik. Das könnte mittelfristig auch Auswirkungen auf Europa haben. Zudem sehen wir, dass der Vorwurf der Zensur zunehmend gegen Regulierungsvorhaben der EU und damit verbundene Maßnahmen gerichtet wird, an denen auch Medien beteiligt sind. Dies könnte das Vertrauen in den Qualitätsjournalismus weiter untergraben.
Welche Gegenbewegungen gibt es? Können Regierungen oder Plattformen gegensteuern?
Die EU fördert zahlreiche Projekte in diesem Bereich. Der Digital Services Act (DSA) könnte beispielsweise zu stärkeren Monitoring-Möglichkeiten führen, was eine bessere Analyse von Desinformation ermöglicht. Dennoch bleibt abzuwarten, ob sich die Plattformen langfristig an Maßnahmen beteiligen und diese wirkungsvoll umsetzen.
Besonders besorgniserregend ist, dass in den USA Unternehmen wie Meta ihre Schutzmaßnahmen zurückschrauben. Sollte sich dieser Trend auf Europa ausweiten, könnte das die Glaubwürdigkeit digitaler Inhalte weiter untergraben und auch der Zensurvorwurf könnten lauter werden.
Wichtig wäre auch eine aufmerksame und konstruktive Moderation auf den Plattformen – und natürlich ein entsprechendes Klima in digitalen Diskursen, wobei ich Zweifel habe, inwiefern sich dieses Klima auf den Plattformen mit ihren Mechaniken herstellen lässt.
Welche Rolle spielen Medienorganisationen in diesem Prozess?
Medien können Diskursräume bereitstellen oder verbessern, indem sie vertrauenswürdige Informationen bereitstellen, Falschaussagen korrigieren und den nötigen Kontext liefern, damit Aussagen richtig eingeordnet werden können. Natürlich werden Medien weiterhin versuchen, möglichst viele Menschen mit verlässlichen Informationen zu erreichen. Gerade junge Zielgruppen, die klassische Nachrichtenangebote immer weniger konsumieren, müssen über andere Kanäle angesprochen werden. Das betrifft auch Medienkompetenzangebote, die zudem auch stärker in Schulen und Lehrerfortbildungen integriert werden sollten. Die Herausforderung besteht darin, Menschen dazu zu ermutigen und zu befähigen, sich reflektiert mit Informationen auseinanderzusetzen und faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.
Gibt es eine Prognose für die Zukunft des digitalen Raums in Bezug auf Desinformation?
Es ist schwer vorherzusagen, wie sich die digitale Welt entwickeln wird. Die Dynamik ist rasant, und Prämissen können sich schnell ändern. Beispielsweise konnte man nicht vorhersehen, wie stark sich die Plattformstrategien in den vergangenen Monaten verändert haben. Spätestens wird die nächste Bundestagswahl zeigen, ob Regulierungen greifen oder ob Plattformen weiterhin eine große Rolle in der Verbreitung von Desinformation spielen. Aber wir werden dieses Thema natürlich auch weiterhin beobachten, innerhalb von GADMO und weiteren Projekten am Institut für Journalistik.
Zum Abschluss: Was können wir aus dem Diskurs rund um die Bundestagswahl mitnehmen?
Während des Wahlkampfs haben wir zahlreiche Falschmeldungen beobachtet, rund um einzelne Kandidaten, den Wahlprozess oder polarisierende Themen wie Migration oder Energiewende. Diese Narrative fanden sich durchaus auch im politischen Diskurs wieder. Und es wurde im Rahmen der aktuellen Regulierung einiges unternommen, um dem entgegenzuwirken. Allerdings scheint das öffentliche Interesse an dem Thema nach der Wahl wieder abzunehmen. Das liegt wohl auch daran, dass die potenziellen Auswirkungen nicht mehr so drastisch sind. Gleichzeitig bleibt der digitale Diskurs oftmals faktenfern. Viele Menschen teilen auch Informationen, von denen sie wissen, dass sie nicht stimmen, weil sie zur eigenen Gruppenidentität passen oder Aufmerksamkeit generieren. Das stellt Journalistinnen und Journalisten vor die Herausforderung, faktenbasierte Berichterstattung so aufzubereiten, dass sie auch diejenigen erreicht, die sich eher in Echokammern bewegen.
Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass Faktenchecks allein oft nicht ausreichen. Um eine Falschmeldung wirklich aus der Erinnerung zu bekommen, braucht es eine alternative Erzählung, die emotional ebenso ansprechend ist. Das ist eine große Herausforderung für den Journalismus, aber auch eine wichtige Aufgabe für die Zukunft. Solche psychologischen Faktoren sollten wir anerkennen und berücksichtigen. Menschen sind vielleicht stark verunsichert, fühlen sich im politischen System nicht wohl. Dann kann man natürlich Faktenchecks veröffentlichen und damit einen wertvollen Beitrag leisten, aber das alleine wird vielleicht nur von wenigen Diskussionsteilnehmern wahrgenommen. Wir sollten also die Perspektive und die Bedürfnisse der Menschen noch stärker in den Blick nehmen und überlegen: Wie verhindern wir, dass Falschinformationen verfangen? Und was stellen wir ihnen entgegen, das Menschen ebenso stark anspricht?
Weiterführende Informationen finden Sie hier: https://www.tu-dortmund.de/nachrichtendetail/gegen-desinformation-vor-der-bundestagswahl-48861/
Schlagwörter:Beeinflussung, Bundestagswahl, Desinformation, Interview, KI, PROMPT