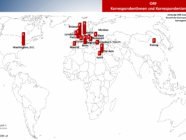Erstveröffentlichung: Weltwoche 13/10
Die Kooperation von Ringier und Springer ist das ziemliche Gegenteil von dem, was alle sagen.
Journalisten, wie wir wissen, hassen nüchterne Fakten. Journalisten, wie wir wissen, lieben dafür berauschende Spekulationen.
Das wurde beim Joint Venture der Medienhäuser Ringier und Springer erneut eingängig vorgeführt. Kaum war die 50:50-Fusion der beiden Osteuropa-Aktivitäten publik, schrieben die Journalisten schon das Ende von Ringiers Unabhängigkeit herbei. Die NZZ spekulierte, «dass die Familie Ringier einen langsamen Abschied vom Mediengeschäft ins Auge fasst». Die «Tagesschau» fabulierte, dass «spätestens bei der Nachfolge von Michael Ringier» wohl auch seine Firma verschwinden werde.
Die Fakten sind anders. Ringier wird auf lange Zeit hinaus ein Familienunternehmen bleiben.
Bevor wir zu den Hintergründen kommen, kurz die Besitzverhältnisse. Die Ringier AG gehört zu je einem Drittel dem VR-Präsidenten Michael Ringier und seinen beiden Schwestern Annette und Evelyn. Er hat die Stimmenmehrheit, um flexibel agieren zu können.
Die drei haben nun einen interessanten Entscheid gefällt. Sie haben ihre Familienfirma für die Zukunft gesichert, gerade weil sie sich von einem Teil der Firma trennten.
Die Teilfusion mit Springer ist von der Investitionsstrategie getrieben. Ringier weiß, dass die Zukunft der Branche digital ist. Man ist darum das einzige Schweizer Medienhaus mit einer konsequenten Internet-Strategie. Man setzt nicht primär, wie die anderen, auf ertragsschwache News und Inhalte im Netz, sondern auf margenstarkes Shopping und Ticketing.
In Osteuropa steht der Aufbau dieser Transaktions-Plattformen noch an. Das kostet Hunderte von Millionen, weil eine starke Marktposition nur über teure Übernahmen erkauft werden kann. Ringier allein schafft das nicht. Mit Springer entsteht nun ein Unternehmen mit über 600 Millionen Franken Umsatz und einem künftigen net cash flow um die 100 Millionen. Damit ist ein ansehnlicher Eigenfinanzierungsgrad gesetzt.
Für die Kosten der digitalen Zukunft wird aber auch das nicht genügen. Darum ist ums Jahr 2014 der Börsengang geplant. Das sollte nochmals Hunderte von Millionen für künftige Investitionen bringen. Ringier und Springer werden allerdings maximal 49 Prozent der Aktien abgeben.
Auch bis dahin schlägt sich das Joint Venture in Ringiers Bilanz nieder. Die Auditoren haben ein ungewöhnliches Konstrukt akzeptiert. Springer, weil börsenkotiert, kann das gemeinsame Unternehmen voll konsolidieren. Aber auch Ringier ist eine 50-Prozent-Konsolidierung zugestanden worden.
Entspannter Chef
Ringier hat damit seine Zukunft und sein Wachstum abgesichert. Das Risiko vieler privater Firmen hohe Verschuldung oder tiefe Investitionsrate ist durch den Deal vermieden worden. «Wir fühlen uns bestärkt, ein Familienunternehmen zu bleiben», sagt Michael Ringier heute.
Es ist kein Zufall, dass die Risikoabsenkung gerade jetzt aktuell wurde. Das Jahr 2009 hat den drei Geschwistern Ringier wieder einmal klargemacht, in welchem high risk-Geschäft ihr Vermögen steckt. Der Cashflow halbierte sich glatt, der Gewinn sank von über 100 Millionen auf einen bescheidenen zweistelligen Millionenbetrag.
Der 61-jährige Michael Ringier wirkt in diesen Tagen außerordentlich entspannt. Wenn man ihn fragt, wie lange er noch im Unter nehmen bleibe, dann antwortet er mit einer Gegenfrage: «Wie alt ist eigentlich Nicolas Hayek?»
Wenn man fragt, wer also in fünfzehn, zwanzig Jahren an seine Stelle trete, dann wird er sehr konkret. Schwester Evelyn hat zwei talentierte Söhne. Die Familie traut ihnen zu, dass sie das Haus Ringier von der fünften in die sechste Generation führen. Nun erst recht.
Schlagwörter:Ringier, Schweiz, Springer, Verlegerfamilie