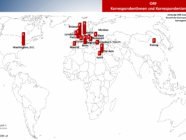Erstveröffentlichung: Neue Zürcher Zeitung
«Auflagengeile Schweinereien, ordinärer Schwachsinn und eine journalistische Nassforschheit» griffen auch deshalb um sich, «weil eine gute journalistische Ausbildung teuer ist und immer mehr Medienunternehmen sich das nicht mehr leisten wollen» – solch starke Worte wählte kürzlich der Leitartikler Heribert Prantl in der «Süddeutschen Zeitung». Unsere Analyse der Ausbildungssituation in der Schweiz und in Deutschland ergibt ein differenzierteres Bild.
Drei alte Pfade zum Einstieg
Nach Rom mögen viele Wege führen, in den Journalismus gelangt man über drei breitgetrampelte Pfade: Volontariate, der Besuch privater Journalistenschulen oder ein einschlägiges Hochschulstudium ebnen den Zugang in die Redaktionen. Vor allem zwei Entwicklungen dürften in den letzten Jahren dazu beigetragen haben, dass die Angebote vielerorts gründlich renoviert wurden:
- Die Krise im Mediensektor führte dazu, dass viele Redaktionen geschrumpft sind und es zu mindest temporär für Berufsanfänger kaum Einstiegschancen gab. Das Interesse an Medienberufen liess deshalb zwar kaum nach; Studienanfänger in den Kommunikationswissenschaften orientieren sich heute aber scharenweise in Richtung Public Relations. Vor zwanzig Jahren strebten dagegen schätzungsweise 80 bis 90% der Erstsemester in den Journalismus.
- An den Hochschulen werden die meisten Studiengänge im Blick auf das Bologna-Modell renoviert. Die Mehrzahl der Studenten soll einen dreijährigen «professionalisierenden» Bachelor erwerben. Ursprünglich war vorgesehen, nur einen kleinen Teil erfolgreicher Studierender zum stärker wissenschaftlichausgerichteten Master-Programm zuzulassen. In der Schweiz ist man dieser Vorgabe von Anfang an nicht gefolgt.
Rückläufige Zahl von Journalisten
Welche der eingangs genannten drei Pfade an Bedeutung gewinnen, darüber geben für Deutschland Daten Auskunft, welche die Kommunikationsforscher Siegfried Weischenberg, Armin Scholl und Maja Malik im vergangenen Jahr erhoben. Seit Anfang der neunziger Jahre ging die Gesamtzahl der hauptberuflichen Journalisten von 54 000 auf 48 000 zurück. Der Anteil der Journalisten mit einem Studienabschluss stieg indes von 65 auf 69%. Abgenommen hat aber der Anteil der Journalisten, die mit einem einschlägigen Studium in den Beruf gelangten – sei das die Journalistik (von 21 auf 14%) oder die Kommunikations- und Medienwissenschaft (von 18 auf 17%). Im Vergleich stieg der Anteil der Journalisten mit Volontariat (von 61 auf 69%); auch der Anteil unter den Einsteigern, die eine Journalistenschule absolvierten, nahm zu (von 10 auf 14%). Die genannten Zahlen addieren sich zu mehr als 100% auf, weil ein Teil des Nachwuchses verschiedene Zugangspfade kombiniert.
Diese Statistik ist deshalb bemerkenswert und alarmierend zugleich, weil die Ausbildungsangebote an den Universitäten und vor allem an den Fachhochschulen in den letzten Jahrzehnten stark ausgeweitet wurden, die Absolventen aber offenbar Schwierigkeiten haben, ohne zusätzliches Volontariat oder den Besuch einer Journalistenschule den Berufseinstieg zu finden. Für die Schweiz fehlen neuere Erhebungen.
Konsolidierung an den Privatschulen
Angehende Journalisten achten auf die Qualität der Ausbildung, auf Einstiegschancen und auf ökonomische Anreize. Stimmt dies, so landet die Crème de la Crème des Nachwuchses meist an einer der Journalistenschulen – und zwar vorzugsweise an jenen, die von den grossen Medienkonzernen mitgetragen werden. Sie können am ehesten einen Anschluss-Arbeitsvertrag in Aussicht stellen. Um Talente anzulocken, gewähren einige recht grosszügige Ausbildungsbeihilfen.
In der Schweiz gibt es starke Zentralisierungstendenzen: Das MAZ, die Schweizer Journalistenschule in Luzern, konnte gegen den Trend im übrigen deutschsprachigen Raum ausgebaut werden – was aber gewiss auch mit den beiden grössten Zürcher Medienunternehmen zu tun hat: Tamedia lagerte ihre Weiterbildungsaktivitäten ans MAZ aus, und Ringier stellte vor ein paar Jahren seine hauseigene Ausbildung ein – «vorübergehend», wie Prisca Wolfensberger von der Kommunikationsabteilung betont.
In Deutschland leisten sich praktisch alle grossen Medienunternehmen ihre eigenen Journalistenschulen. Deren Leiter sprechen übereinstimmend von einer Konsolidierung. Es habe in den letzten beiden Jahren kaum noch Budgetkürzungen gegeben, da und dort werde behutsam ausgebaut. Auch die Übernahmequoten sind wieder besser – 80 bis 90% der Absolventen sind es etwa bei Springer. Bei der 2001 gegründeten Burda- Journalistenschule wurden anfangs alle übernommen; das sei aber, so ihr Leiter Hanspeter Oschwald, schwieriger geworden. Häufig werden befristete Arbeitsverträge abgeschlossen; mancher Absolvent hangelt sich von Vertretungs- zu Vertretungsjob oder arbeitet als freier Mitarbeiter.
Um an einer Journalistenschule aufgenommen zu werden, sind ein Studium – eher klassische Fächer (Geschichte, Wirtschaft, Jura, Naturwissenschaften) als Journalistik oder Kommunikationswissenschaft – sowie erste journalistische Erfahrungen hilfreich. Praktika werden häufig nicht mehr bezahlt. An der Springer-Journalistenschule haben, so deren stellvertretender Leiter Rudolf Porsch, inzwischen 85% der Volontäre ein abgeschlossenes Studium, rund 10 %sind sogar promoviert. Die Ausbildungszeiten werden offenbar eher länger als kürzer.
Umstellung auf das Bologna-Modell
Zugleich zeichnet sich eine noch stärkere Spaltung des Markts als bisher ab. Während nur wenige Einsteiger einen der raren Plätze an den renommierten Schulen bekommen, muss sich das Gros der Nachwuchsjournalisten unter weniger günstigen Bedingungen durchboxen. Überfüllte Hörsäle, schlecht koordinierte Lehrangebote und überlange Studienzeiten gehören vielerorts seit Jahren zum Hochschulalltag.
Inzwischen sind Universitäten und Fachhochschulen dabei, auch in der Journalistik und der Kommunikationswissenschaft auf das Bologna- Modell umzustellen. Damit gerät etwas in Gefahr, was bisher eher zu den Errungenschaften der hochschulgebundenen Journalistenausbildung zählte. Weischenberg hatte Anfang der neunziger Jahre eine Trias journalistischer Kompetenz als notwendig vorgegeben: Medienbezogenes Fachwissen, Sachkunde im Berichterstattungsfeld und Vermittlungskompetenz sollten sich ergänzen. Besonders leicht liess sich dieser Dreiklang im Rahmen eines klassischen Magisterstudiums intonieren. Die Kombination aus zwei Hauptfächern oder einem Hauptfach mit zwei Nebenfächern erlaubte es, parallel in allen drei Bereichen das nötige Wissen zu vertiefen. Ähnlich, nur noch praxisnäher, waren auch die meisten Diplomstudiengänge in Journalistik konzipiert.
Dagegen stellt das neue Modell diese «Kompetenz-Trias» in Frage: Ein meist dreijähriger Bachelor zwingt dazu, sich auf ein Fach zu konzentrieren. Am Journalismus interessierte Studierende haben so erst einmal die Qual der Wahl zwischen Fach- oder Sachkompetenz. Mindestens ein Bereich droht ins Bologna-Loch zu fallen.
In Deutschland waren kleinere Hochschulen mit der Umstellung besonders schnell; manches neue Angebot ist allerdings sehr markteng, beispielsweise Journalismus mit Schwerpunkt TV- Producer. Ressortspezifische Studiengänge – etwa zum Wissenschafts-, Kultur- oder Wirtschaftsjournalismus, wie sie sich an der Universität Dortmund, der Universität der Künste in Berlin, der Hochschule Bremen oder der privaten BiTS-Hochschule in Iserlohn finden – weisen vielleicht einen Ausweg aus dem Dilemma.
Online-Studienführer verzeichnen unter fast 100 Ausbildungsangeboten, die sich in der Schweiz und in Deutschland der Journalistik zuordnen lassen, erst rund 20 Bachelors und knapp 10 Master-Angebote. Ein Vorreiter bei der Umstellung in der Schweiz ist die Zürcher Hochschule Winterthur. Seit Herbst 2005 wird dort am Institut für Angewandte Medienwissenschaft (IAM) ein Bachelor in «Kommunikation: Studienrichtung Journalismus und Organisationskommunikation» angeboten. «Unser Institut war von Anfang an auf Bologna hin ausgerichtet und hat damit in den Berufsfeldern wie auch im Hochschulnetz gute Erfahrungen machen können», so IAM-Leiter Daniel Perrin. «Bologna bietet Chancen: Mehr Transparenz, weil Lehr- und Lernziele auszuweisen sind. Mehr Mobilität, weil Studierende leichter die Hochschule wechseln können – auch ins Ausland.»
Übergangsphase
Die grossen kommunikationswissenschaftlichen Institute in Deutschland stecken derzeit meist noch in der Übergangsphase. Drei Beispiele: In München ist ein neues Masterprogramm vorgesehen. Es soll die erfolgreiche Kooperation mit der Deutschen Journalistenschule fortsetzen. Bereits seit 2003 bietet die Universität einen Bachelor of Arts in Kommunikationswissenschaft an. In Hamburg gibt es einen neuen Masterstudiengang «Journalistik und Kommunikationswissenschaft». Parallel bietet die Universität mit der Hamburg Media School einen Master of Arts in Journalism an – ein Projekt, in das auch das MAZ in Luzern einbezogen ist. Die Universität Mainz plant eine Art Doppel-Bachelor, der Nebenfächer ins Publizistikstudium integriert. Allerdings sieht ein Lehrender im Hintergrundgespräch auch das Risiko, mit dieser Kombination geradezu ein Weiterstudieren zu erzwingen, wenn nicht halbgebildete Akademiker auf die Redaktionen losgelassen werden sollen.
Während an Ausbildungsstätten wie dem MAZ oder der Evangelischen Journalistenschule in Berlin Studierende sogar erfahrene Journalisten als persönliche Mentoren haben, sind Massen- und Schulbetrieb, wie sie inzwischen an Hochschulen gang und gäbe sind, einer guten Journalistenausbildung eher abträglich. An den Hochschulen schwinden eigenständiges Forschen, ja oft schon selbständige Literaturrecherche und die Bereitschaft, regelmässig Zeitung oder auch nur pro Seminar mehr als ein Buch zu lesen.
So nimmt es nicht wunder, dass etwa die Springer-Journalistenschule in jüngster Zeit mehr das Sachwissen akzentuiert. Akademiker lernen auch das Recherchieren. Irgendwie nachvollziehbar, dass solche Anstrengungen geadelt werden möchten, indem jüngst die Journalistenschule zu einer hauseigenen Akademie aufgewertet wurde.
Ausbildung insgesamt besser denn je
Wenn also Schweinereien, Schwachsinn und journalistische Nassforschheit um sich greifen, ist womöglich doch nicht die Ausbildung dafür in Haft zu nehmen. Im Gegenteil: «Verleger, Chefredaktoren und auch die jungen Berufseinsteiger selbst», meint die Direktorin der Schweizer Journalistenschule MAZ, Sylvia Egli von Matt, «sind sich heute stärker bewusst, dass eine fundierte Ausbildung wichtig ist.» Trotz allen erkennbaren Defiziten und Mängeln ist diese insgesamt wohl besser denn je. Mit Einschränkungen gilt das sogar für die Hochschulen. Im Rückblick mutet es tragisch an, dass sich Journalistik und Kommunikationswissenschaft als stark frequentierte Fächer erst spät etablieren konnten – so spät, dass ihr Ausbau mit der Zerstörung dessen zusammenfiel, was einmal die Raison d’être der Universität war: die intensive, persönliche Kommunikation zwischen Forschenden und Lernenden.
Schlagwörter:Deutschland, Journalismusausbildung, Schweiz