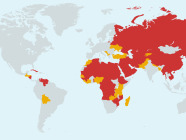Stärken Korrekturspalten die Glaubwürdigkeit der Medien?
In den USA sind viele Zeitungen bestrebt, Fehler in der Berichterstattung nachträglich zu korrigieren. Sie wollen damit auch ihre Glaubwürdigkeit stärken. Die europäischen Kollegen tun sich schwerer mit dieser Praxis.
«Je mehr jemand Medienaufmerksamkeit erzielt, desto öfter ist er auch Opfer von Medienirrtümern – das ist die Regel», sagt Craig Silverman in seiner jährlichen Bilanz journalistischer Fehler, die er auf seinem Blog (www.RegretTheError.com ) publiziert. Der amerikanische Medienjournalist hatte bereits im Jahr zuvor genüsslich nachgewiesen, dass Präsident Obamas Vor- und Nachname viele Journalisten in Kalamitäten gebracht habe. Der Nachrichtensender CNN und das Boulevardblatt New York Post hätten ihn beispielsweise Osama genannt.
Ein Fundament der Glaubwürdigkeit
Silverman, der inzwischen als Buchautor hervorgetreten ist,* kann freilich seiner Arbeit nur nachgehen, weil sich die Journalismuskulturen der Alten und der Neuen Welt an einem entscheidenden Punkt grundlegend unterscheiden: In Amerika besteht ein Konsens, dass Fehler korrekturbedürftig sind und es der Glaubwürdigkeit von Redaktionen aufhilft, wenn sie diese freiwillig berichtigen. «Akkuratesse ist das Fundament, auf dem alles andere aufbaut: Kontext, Interpretationen. Debatten, die gesamte öffentliche Kommunikation. Wenn das Fundament nicht trägt, wird alles andere beschädigt», halten Bill Kovach und Tom Rosenstiel fest, die sich mit dem Committee of Concerned Journalists an die Spitze der Bewegung gesetzt haben, welche Qualität im Journalismus einfordert.
Ebenso bemerkenswert sind die Forschungsanstrengungen, mit denen Berichterstattungsfehlern nachgespürt wurde. Bereits 1936 hat Mitchell Charnley die erste systematische Studie vorgelegt. Er war Chef vom Dienst bei einem Lokalblatt und Journalistikdozent an der University of Minnesota. Insgesamt hat er 1000 Artikel von 3 Lokalblättern zusammengetragen und sie an diejenigen Akteure zurückgeschickt, die in den Beiträgen als Quellen genannt waren. Mit ihrer Hilfe hat er herausgefunden, dass knapp die Hälfte der untersuchten Artikel (46 Prozent) Fehler enthielten. Sein Vorgehen hat bis heute die einschlägige Forschung geprägt.
Fehler in 61 Prozent der Berichte
Charnleys Studie wurde inzwischen mehrfach wiederholt – Tendenz: Die Fehlerzahl nimmt langfristig zu. 61 Prozent der selbsterstellten Berichte und Features in Zeitungen enthalten mindestens einen Fehler – so ermittelte Scott R. Maier von der University of Oregon vor drei Jahren in der bisher grössten Studie, in der 4800 Artikel aus 14 verschiedenen Zeitungen untersucht wurden. Maier hielt sich kürzlich im Tessin auf, weil an der Universität Lugano seine Studie für die Schweiz und für Italien repliziert wird.
Immerhin berichtigen fast alle US-Zeitungen Falschmeldungen in «correction corners», also an festen Plätzen im Blatt. Dies hebt sich wohltuend ab von den Vertuschungsmanövern und vom Beschweigen der eigenen Unzulänglichkeiten in europäischen Medien. Eine grosse Mehrheit (58 Prozent) der US-Zeitungsjournalisten glaubte allerdings vor ein paar Jahren noch, dass «stets» eine Berichtigung einem entdeckten Berichterstattungsfehler folgt. Die Leser und Leserinnen waren da weitaus realistischer: Nur knapp 20 Prozent von ihnen stimmten dieser Aussage zu.
Nimmt man die von Maier ermittelte Fehlerquote zum Massstab, bedürfte es – so der Forscher im Gespräch – «eher einer ganzen <Corrections>-Seite, wenn nicht mehr nur mehr oder minder zufällig berichtigt werden soll». Bei 10 grösseren Regionalzeitungen, die er unter die Lupe nahm, fand er heraus, dass – ganz im Gegenteil zur Selbsteinschätzung der Journalisten – mehr als 98 Prozent aller Fehler nicht richtiggestellt wurden (NZZ 3. 3. 06). Leitet Maier damit Wasser auf die Mühlen all der Redaktionen in Europa, die sich erst gar nicht um Berichtigungen bemühen? Nein, denn andere Untersuchungen bestätigen klar, dass die amerikanischen Leser mit einer knappen Zweidrittelmehrheit (63 Prozent) Korrekturspalten zu schätzen wissen.
Die Herausforderung besteht somit wohl eher darin, zuverlässiger als bisher Fehler in der Berichterstattung zumindest dann zu berichtigen, wenn sie desinformierend wirken. Allerdings ist Überzeugungsarbeit nötig. Selbst wenn diese gelingt, bleiben zwei Probleme: «Es gibt keine Auszeichnungen für präzise Berichterstattung», sagt Maier. Gerade weil Akkuratesse als Selbstverständlichkeit erwartet wird, fehlt es an Anreizen für den Einzelnen, sich übermässig darum zu kümmern – zumal erfahrene Journalisten damit rechnen, dass die meisten Quellen, sei es aus Apathie oder Desinteresse, aus Angst oder Kosten-Nutzen-Kalkül, auf Fehler nicht mit Gegendarstellungen reagieren. Es gibt meist auch keine Sanktionen bei Nichtberichtigung.
Gründliche Chicago Tribune
Das bisher gründlichste Projekt, um Fehler zu reduzieren, wurde Ende der neunziger Jahre bei der Chicago Tribune gestartet. Das ging nicht ganz ohne bürokratisch-buchhalterischen Aufwand. Jeder Fehler wurde systematisch erfasst, es wurde ermittelt, wer ihn beging und wie er entstehen konnte, wer ihn entdeckt hat und ob er vermeidbar gewesen wäre. Schliesslich wurde ein «Error Policy Manual» erstellt, ein regelrechtes Handbuch zur Vermeidung von Fehlern.
Man kann sich vorstellen, dass der Vorstoss keine Begeisterungsstürme in der Redaktion ausgelöst hat. Fehler zu erfassen, war lästig. Reporter und Redakteure befürchteten «Bestrafung» für ihre Unterlassungssünden. Diese Ängste schwanden zwar – dem damaligen Chefredaktor, Howard Tyner, gelang es, sie zu zerstreuen. Er konnte innerhalb von fünf Jahren die Zahl der aufgedeckten Irrtümer nahezu halbieren: von statistisch 4,5 auf 2,5 Fehler pro Seite.
Wie gross sind die Chancen, dass andere Redaktionen vergleichbare Initiativen entfalten? Scott Maier ist nicht sonderlich optimistisch: Für den einzelnen Journalisten bleibe ein Anreiz, Fehler zu vertuschen, statt sich freiwillig an den Pranger zu stellen, der eine Korrekturspalte im Binnenverhältnis zu den Redaktionskollegen allemal auch ist. Selbst wenn Autorenname oder -kürzel in der Berichtigung nicht genannt würden – in der Redaktion wissen alle, wem der Fehler zuzuschreiben ist. So schadet der Einzelne seiner Reputation, wenn er gewissenhaft berichtigt, während seine Kollegen fünfe gerade sein lassen. Maier erklärt damit plausibel, weshalb sich das Engagement der leitenden Redaktoren, eine Berichtigungskultur durchzusetzen, auch in den USA in überschaubaren Grenzen hält.
«Das Erreichbare erreicht»
Jack Shafer vom Online-Magazin Slate hat recht, wenn er Fehlervermeidung und -berichtigung letztlich als ein ökonomisches Problem, eine Frage von Aufwand und Ertrag, sieht. «In der Kosten-Nutzen-Analyse der Fehlervermeidung haben die Zeitungen wohl das erreicht, was sinnvollerweise erreicht werden kann», meint er. Da widerspricht allerdings Scott Maier, der jahrelang in einer Redaktion gearbeitet hat, bevor er Forscher wurde. Reporter und Redaktoren sollten sich einfach immer wieder zwei Fragen stellen, um mehr Präzision und Glaubwürdigkeit zu erzielen: «Wieso weiss ich das?», um «harte» Faktenfehler zu identifizieren. Und: «Was werden diejenigen empfinden, die in der Geschichte vorkommen, wenn sie sie lesen?», um weichere, «subjektive» Fehler zu vermeiden.
Maier konzediert, dass Korrekturspalten nicht das Glaubwürdigkeitsproblem des Journalismus lösen könnten: «Wichtiger, als alle Fakten richtig hinzubekommen, ist es immer noch, wie eine Geschichte <gespielt> wird – Tönung, Quellen, Relevanz, Perspektive, das ist es, was wirklich zählt.» Er könne durchaus verstehen, weshalb Redaktionen in der Schweiz und in Deutschland so zögerlich auf ihre Fehler aufmerksam machten.
Ein Muss aus vier Gründen
Aber aus seiner amerikanischen Perspektive sei Fehlerkorrektur aus vier triftigen Gründen ein Imperativ: Erstens müsse eine glaubwürdige Zeitung Fehler und Missverständnisse ausräumen. Zweitens würden Fehler, die nicht berichtigt werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholt, insbesondere seitdem mit dem Internet Information unkontrolliert überallhin diffundiert. Drittens steigere es die eigene Glaubwürdigkeit, wenn Fehler offengelegt werden. Und viertens sei Präzision nun einmal das Kriterium, mit dem sich professionelle Journalisten in der heutigen Welt informeller Kommunikation gegenüber Bloggern und Bürger-Journalisten unterscheiden könnten.
Der nimmermüde Craig Silverman empfiehlt, das Schreiben von Berichtigungen zur «Kunst» zu entwickeln. Als Vorbild nennt er Ian Mayes, den langjährigen Ombudsmann des britischen Guardian, der während seines Mandats 90 000 Beschwerden von Lesern entgegengenommen und 14 000 Berichtigungen für seine Zeitung verfasst habe. Er habe daraus regelrechte Preziosen gemacht, aber stets mit wenigen Worten verdeutlicht, wie ernsthaft er sich mit Fehlern auseinandersetze, wenn sie Schaden angerichtet haben. Eine Kostprobe seines britischen Humors: «Wir haben Morecambe, die Stadt in Lancashire, gestern auf Seite 2 falsch geschrieben. Das passiert uns öfters.» Und ein halbes Jahr später: «Das gestrige Fehlen von Berichtigungen ist Folge einer technischen Panne – und nicht etwa eines plötzlichen Anfalls von journalistischer Unfehlbarkeit.»
Craig Silverman: Regret the Error. Sterling Publishing, New York 2007.
Schlagwörter:Glaubwürdigkeit, Korrektur