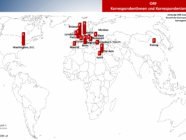Schweizer Journalist 8 + 9 / 2008
In der Schweiz greift das Gratisfieber auf die Magazinwelt über. Europaweit dagegen haben Pendlerblätter Probleme. Langfristig aber ist der Gratisboom auch hierzulande bedroht.
Es war wie ein Märchen. Die Macher der Pendlerblätter erschienen als Flötenspieler, mit denen man die widerspenstigen, jüngeren Leser zurücklocken konnte, um gemeinsam in eine paradiesische Zukunft zu spazieren. In Europa wuchs die Auflage in Höchstgeschwindigkeit: von 2000 auf 2004 verdoppelte sie sich auf 11 Millionen Gratisexemplare, zwei Jahre später waren es 26 Millionen, im März 2008 dann 28 Millionen: 130 Titel, mehr als 300 Ausgaben breiten sich aus über Europa. In Island, Dänemark, Spanien und Portugal überholten die Auflagen der Gratisblätter in der Summe die der Kaufzeitungen. Und als in der Schweiz das dem Schibstedt-Konzern abgekaufte Pendlerblatt „20 Minuten“ im Stall der Tamedia zum Goldesel wurde, wollten auch die anderen Verleger ein solches Geldvieh in ihrem Stall.
Gratisboom. Die Zahlen klingen nach Erfolg: Nirgendwo in Europa werden gegenwärtig mehr Gratistageszeitungen pro Kopf gedruckt als in der Deutschschweiz. Die Tamedia zählte täglich ein Exemplar für jeden zweiten Einwohner über 14 Jahren in einem Auflagenvergleich, den sie für ihre Bilanzmedienkonferenz erstellte. Gegenwärtig wird der Marktanteil der Gratispresse in der Schweiz auf 45 Prozent geschätzt. Es gibt sieben Pendler-Tageszeitungen: „20 Minuten“ (1999), „Baslerstab“ (2000), „Le Matin Bleu“(2005), „Heute“ (2006) – 2008 vom Markt genommen und durch „Blick am Abend“ ersetzt, „Cashdaily“ (2006, Wirtschaft), „.ch“ (2007), „News“ (2007). Unter den Gratis-Wochenzeitungen sind alte Hasen wie das „Migros-Magazin“ und die „Coop-Zeitung, sowie junge Rehe: Filippo Leutenegger brachte vor knapp einem Jahr „Neue Ideen“ auf den Markt, ein Fachblatt für alles rund ums Wohnen. Für Ende Oktober kündigte die Tamedia ein neues People-Magazin an. „Friday“ soll jeweils am Freitagabend erscheinen und über Themen rund ums Ausgehen bewegen: Leute, Lifestyle, Mode, Trends. Dafür wird Ende des Jahres das bisherige Ausgehmagazin „Week“ eingestellt.
„Gut auf Kurs“, fühlt sich auch Filippo Leutenegger. Bis hin zu den ersten Wemf-Zahlen sei das Geschäft besonders hart für ein neu lanciertes Projekt. Doch die Mühe habe sich gelohnt: „Neue Ideen“ erreiche im September, nach bereits knapp einem Jahr den Breakeven und finanziert sich dann voll durch Anzeigen und die Beiträge der gegenwärtig 5000 Mitglieder.
Alarmzeichen. Im Ausland dagegen schreibt die „Gratis“-Branche bereits rote Zahlen. Piet Bakker, Kommunikationsforscher an der Universität Utrecht, zeichnet in der jüngsten Ausgabe des Fachmagazins „In Circulation“ ein düsteres Bild. Der „Metro“-Konzern, der Pionier, der 1995 das erste Gratisblatt platzierte, hatte einen Markt mit 23 Millionen Lesern in 23 Ländern (und 19 Sprachen), den Anspruch, die wahre globale Zeitung zu sein und Träume von Königreichen voller Geld. Doch bislang konnte der Konzern mit seinen 70 Ausgaben lediglich den Verlust reduzieren; im zweiten Quartal 2008 erreichte das Anzeigengeschäft einen Tiefpunkt.
Bakker rechnet zusammen. Ein Viertel der Gratisblätter ist bereits pleite, von den verbliebenen 320 Titeln sind 70 Prozent in den roten Zahlen. Die Anzahl der verteilten Exemplare verlangsamte sich auf sechs Prozent. In Dänemark hat jüngst gar der Marktführer aufgegeben. Der Grund: Trotz des Erfolgs im Lesermarkt fehlte die wirtschaftliche Perspektive.
Per Mikael Jensen begründet die Verluste bei „Metro“ mit Investitionen in das Wachstum, will seine Marke, ähnlich wie bei der Kaffeehaus-Kette Starbucks, nun auch anderen Verlagshäusern überlassen, träumt vom deutschen Markt und glaubt weiterhin an das Geschäft mit einem Produkt, das gut sei, weil es, anders als klassische Verlagshäuser, Journalismus ohne Meinung biete. „Wir müssen uns nicht um Fragen kümmern wie: Was denken wir über den Irak-Krieg? Denn darüber denken wir gar nichts, wir haben keine politische Meinung“, argumentierte er in der „Süddeutschen Zeitung“.
Die ältesten Hasen unter den kostenlos erscheinenden Wochenzeitungen haben ihre Stammleserschaft und vertiefen mit journalistischer Leistung die Identifikation. Die neuen Gratiszeitungen streuten die Aufmerksamkeit, doch im Wesentlichen änderte sich nichts. „Wer uns liest, hat bereits ein latentes Interesse an der Migros“, sagt Hans Schneeberger, Chefredaktor des Migros-Magazins. „Es gibt Migros-Menschen und Coop-Menschen. Das ist einfach so.“ Zurücklehnen will er sich nicht, sondern plant einen grossen Ausbau des Online-Auftritts, der allerdings noch nicht spruchreif sei.
„Gratis entspricht einer generellen Haltung“, glaubt Schneeberger: „Das Billige ist der Feind des Guten.“ Deshalb bleiben sie auf dem Markt – „und wenn sie dann noch gut gemacht sind, ist es ja umso besser.
Nur Eva Keller, Leiterin der Unternehmenskommunikation der AZ Medien, weist auf die Konjunkturabhängigkeit der Gratispresse hin. …Deshalb haben sie, wie all solche Produkte, ihre Zyklen. Es könne sein, dass sie ihren Zenit schon überschritten haben und schon bald die nächste Phase erreicht ist, in der dann Online und mobile Endgeräte die Hauptrollen spielen. „Die Risiken erschienen uns zu gross, momentan mit einem neuen Produkt in einen solchen Markt einzusteigen. Es fragt sich zudem, wie erfolgreich die bestehenden Pendler-Zeitungen sind. Ich sehe abends noch immer etliche „News“-Ausgaben in den Boxen liegen…“ Es könne sein, dass sie ihren Zenit schon überschritten haben und schon bald die nächste Phase erreicht ist, in der dann Online und mobile Endgeräte die Hauptrollen spielen.
Mobile Gefahr. Der Leipziger Journalismusprofessor Michael Haller untersuchte Gratisblätter in 21 europäischen Ländern und analysiert gegenwärtig Daten weiterer Länder, darunter die Schweiz. Drei Ergebnisse stehen bereits. Erstens: Die Reichweite der Kaufpresse sank nicht wegen der Gratisblätter. In Deutschland, wo die Pendlerblätter bislang keinen Zutritt fanden, sei der Reichweiterückgang der Regionalpresse etwa so gross wie in Ländern mit starker Gratispresse. Zweitens: Gratis oder gekauft – bei beiden entscheide die Qualität, wer überlebt. Drittens: In zehn, fünfzehn Jahren ist bei den heute besonders eifrigen Pendlerblattlesern zwischen 20 und 36 Jahren Papier völlig „out“: Sie füllen die Fahrt zum Arbeitsplatz mit Mobile-Angeboten.
Die Druckausgabe los zu werden, entspricht völlig dem Interesse der Verleger, sagt Tom Rosenstiel, Kenner der amerikanischen Medienbranche, in der „Süddeutschen Zeitung“. Das spare 40 Prozent der Fixkosten. Doch dafür ist es noch zu früh. Denn nach wie vor machen Print-Werbung und Vertrieb 90 Prozent der Einkünfte der meisten Zeitungen aus; online sei nur ein Bruchteil dessen zu erzielen. Bis in zehn Jahren hingegen gebe es nur noch in grossen Städten gedruckte Zeitungen, in mittelgrossen Städten allenfalls alle paar Tage und vielleicht nur als Hybrid: eine limitierte gedruckte Version der Online-Ausgabe.
Offenbar ist die Gratispresse nur ein Phänomen innerhalb eines umfassenden Veränderungsprozesses. Kern ist die Streuung der Aufmerksamkeit auf vielerlei Medien und die Verknappung der Ressourcen – der finanziellen wie der Rohstoff-Ressourcen. Rechnet man das Papier für die gegenwärtige Auflage der Gratispresse in der Deutschschweiz in Holz um, fallen täglich 36 Bäume für Pendlerblätter.
Kahlschlag. Die Gratispresse kann aber zumindest ein Zahnrad sein in diesem Veränderungsprozess, zum Beispiel als Glied multimedialer Verwertungsketten, zu denen sich „Blick am Abend“, „Blick“, Blick-Online-TV am Mittag, Online-News und Sonntagsblatt sowie ein neu gestarteten Mobiltelefon-Angebot verknüpfen. Das ermöglicht inhaltliche Synergien und werbliche, indem sogenannte Cross-Promotion betrieben und für das eine Medienprodukt im anderen geworben wird. Weiterer Vorteil liegt in der Risikostreuung: Ist der Markt für das eine Produkt gesättigt, hilft man sich über ein Plus auf anderen Geschäftsfeldern.
Ausserdem sollte man die Kaufpresse noch nicht abschreiben, argumentiert der Chefredaktor des Tages-Anzeigers, Peter Hartmeier: „Wir müssen uns jeden Tag auf unsere speziellen Aufgaben besinnen: Was ist der Tages-Anzeiger? Worin wollen wir uns unterscheiden? Warum lohnt es sich, für ihn zu bezahlen?“ Sein Rezept lautet: Mehr und weniger. „Noch mehr Regionalisierung, noch mehr Leserorientierung. Und immer weniger Themen, die weit weg sind von den Leuten.“
Schlagwörter:Gratisboom, Pendlerzeitungen, Schweiz