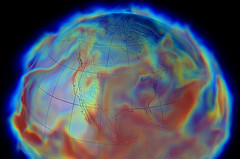Erstveröffentlichung: Neue Zürcher Zeitung
«Bestimmte Gaben verweigert»
Sieburg, einst Starpublizist bei der alten «Frankfurter Zeitung», machte sich über das Treiben der neuen Medienlenker Sorgen. Er schrieb 1948 ein kleines Buch mit dem Titel «Schwarzweisse Magie». Sieburg formulierte darin vorsichtig, aber für seine Verhältnisse deutlich: «Bestimmte journalistische Ausdrucksformen sind uns nun einmal verwehrt und diejenigen Formen, die unsern soziologischen Bedingungen entsprechen, sind noch nicht gefunden, so stürmisch und viel versprechend sie heute wenigstens auf dem Gebiet der Reportage gesucht werden. Warum den Himmel anklagen, dass er uns bestimmte Gaben verweigert und uns dadurch den Journalismus schwerer gemacht hat als anderen Völkern?»
In den zwanziger Jahren hatte Sieburg, Jahrgang 1893, den jüdischen Reporter Joseph Roth vom Posten des Paris-Korrespondenten der «Frankfurter Zeitung» verdrängt, dann mit seinem Buch «Gott in Frankreich?» Furore gemacht und sich im NS-Staat als Diplomat in Ribbentrops Auswärtigem Amt verdingt. Er war ein Mann für alle Jahreszeiten, veröffentlichte expressionistische Gedichte, landete Ende der 1920er Jahre beim jungkonservativen «Tat»-Kreis, schrieb 1932 ein wolkiges Buch mit dem programmatischen Titel «Es werde Deutschland».
Nach 1945 war Sieburg, für einige Jahre mit Publikationsverbot belegt, davon überzeugt, dass «amerikanische Reporterarbeit» in der deutschen Presse nicht funktionieren werde. Wer für die deutsche Presse eine «pädagogische Sendung» fühle, der solle versuchen, «sie auf ihre echten Möglichkeiten zu verweisen, und sie lehren, ihre Quellen sauber zu halten, aus denen ihr Wesen und ihr Ausdruck sich nähren. Hoffnungslos dagegen, ihr einen Stil aufzwingen zu wollen, zu dem in Deutschland die Voraussetzungen fehlen.»
Nationalpädagogische Sendung
Sieburg war kein kauziger Einzelgänger, so wie er dachten viele Altverleger, bürgerliche Journalisten und Politiker. Die gehobene Publizistik war in ihren Augen nationalpädagogische Sendung, gelehrtes Feuilleton, halb akademische, halb politische Arbeit. Königsdisziplinen waren Leitartikel und Rezensionen. Die Tucholskys und Ossietzkys, die in der Weimarer Republik einen weltbürgerlichen, ironisch-distanzierten, von manchen auch als «zersetzend» empfundenen Stil gepflegt hatten, waren ebenso tot wie Joseph Roth, der schon früh aus dem Pariser Exil die Mordbrennerei des NS-Regimes prognostiziert hatte. Er trank sich zu Tode, Tucholsky brachte sich um, Ossietzky starb nach KZ-Haft. Der geschmeidigere Sieburg, den Tucholsky als Paris-Korrespondenten durchaus geschätzt hatte, war 1956 wieder Chef des Literaturteils der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» («FAZ»). Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, nach dem Verbot der alten «Frankfurter Zeitung», hatte Sieburg, in einer bis heute nicht ganz aufgeklärten Episode, als «Ehrenbegleiter» des entmachteten Vichy-Staatschefs Marschall Pétain gedient.
Sieburg, der 1964 starb, bekam noch mit, wie sich die angloamerikanische Medien- und Popkultur im Westen Deutschlands durchsetzte und auf Journalismus und neue deutsche Literatur abfärbte. Ausgerechnet das Blatt, das vollständig von britischen Presseoffizieren konzipiert worden war und dann in die Hände des furiosen Leitartiklers Rudolf Augstein geriet, «Der Spiegel», entfaltete eine publizistische Wirkung, die auch im internationalen Vergleich einzigartig war.
Doch am Beispiel des «Spiegels» lässt sich belegen, wie dialektisch und kompliziert die Verbindung von deutschromantischer Publizistik, deren Räsonnement sich seit dem 18. Jahrhundert stets um Reich, Volk und Staatswerdung drehte, und den ironisch-skeptisch beobachtenden Stiltraditionen der angelsächsischen Demokratien wirklich war. Augstein wollte direkt ins Politische hineinwirken, mitregieren, gegen Adenauers Westbindung und für die Option eines wieder erstarkten Deutschland in der Mitte Europas. Nach seinen publizistischen Vorbildern befragt, nannte er regelmässig deutsche Wortführer wie Heinrich Heine, Ludwig Börne oder Maximilian Harden, den jüdischen Skandalpublizisten des untergehenden wilhelminischen Reiches – nicht etwa angelsächsische Reporter und Rechercheure. Distanzierte Gesellschaftsreportagen ohne eindeutig politische oder kulturell-strategische Wirkungsabsicht waren im «Spiegel» eher selten.
Falsch verstandener New Journalism
Die Entwicklung des New Journalism in den USA der 1960er Jahre durch Autoren wie Tom Wolfe, Gay Talese und Truman Capote, die äusserst realistische sozialpsychologische Beobachtungen in besondere Sprach- und Klangbilder übersetzten, ging am «Spiegel» wie an der übrigen deutschen Presse lange Zeit fast spurlos vorbei. Im New Journalism hatten sich literarische Traditionen von Mark Twain über die Lost Generation, den Sozialrealismus John Steinbecks bis zur Beatnik-Prosa aufsummiert; vor allem Tom Wolfe hatte propagiert, der konventionelle künstlerische Roman werde künftig von der grossen, multiperspektivischen journalistischen Wirklichkeitsreportage abgelöst. In der Bundesrepublik verwechselte man seit den 1980er Jahren systematisch New Journalism mit Zeitgeistjournalismus, schrillen Geschichten aus der Ich-Perspektive oder flachen Society-Beschreibungen.
Dass sich der Journalismus, in der professionellen Spitze, nicht nur im Wettkampf der Meinungen mit der politischen Sphäre auseinandersetzen sollte, sondern in der Ästhetik von Wahrnehmung und Stil auch ein Gegenmodell zum politischen Betrieb darstellen könnte, war schwer zu vermitteln. Journalismus in Deutschland, das ist die Geschichte einer verspäteten Profession, gekennzeichnet von publizistischen Reaktionen auf zahlreiche Sonderwege der Staatswerdung. Ein ums andere Mal, von links bis rechts, wurde die Medienkultur des Auslands, von der «Vertrustung» des Pressewesens bis zur «Nachrichtenjägerei» der US-Reporter, als «wesensfremd» im Vergleich zur umfriedeten Geistigkeit deutscher Regionalzeitungen beschrieben.
Im Jahr 1900 hatte Maximilian Harden mit Karl Kraus korrespondiert, man müsse es dahin bringen, «dass der publicistische Arbeiter die Zeitungen, die er schreibt, auch wirklich leitet und nicht gezwungen ist, täglich zweimal in den höchsten Brusttönen zu verkünden, was er nicht glaubt». Darüber war ja noch zu diskutieren, aber Harden formulierte weiter: «Sonst kommen wir schnell zu amerikanischen Zuständen, und die Journalistik, der heute schon Depeschen und Reportagen wichtiger sind, als Stil, Können, Sachkenntnis und Überzeugung, hört völlig auf, ein Zweig der Literatur zu sein.»
In der Weimarer Republik setzte sich hier und da die Erkenntnis durch, dass vor allem Reportagen etwas mit Stil, Sachkenntnis und auch Überzeugung zu tun hatten. Doch 1933 planierten Goebbels und sein nationalsozialistischer Lenkungsapparat die publizistische Szenerie; die im Reich verbliebenen bürgerlichen Journalisten liessen sich weitgehend einbinden. Es ist einleuchtend, dass bei dieser Vorgeschichte die Identität des Journalismus in der Bundesrepublik fragil blieb. Vieles wurde jetzt angelernt, manches beschwiegen, aber niemand konnte bestreiten, dass sich in den 1960er Jahren, als Resultat der westalliierten Medienpolitik, eine auch im internationalen Vergleich vielfältige und konkurrenzfähige Medienstruktur entwickelte.
Deutscher Neo-Journalismus nach 1989
Hitler und seine Spiessgesellen waren trotz ständiger medialer Wiederauferstehung schon sehr im historischen Nebel verschwunden, als sich in der wieder vergrösserten Berliner Republik nach 1989 ein deutscher Neo-Journalismus herausbildete, der sich in nationalromantischen Reflexionen und retrofuturistischen Befürchtungen wieder mit dem Deutschsein an und für sich auseinandersetzte. Das Leit-Vokabular entsprechender Sachbücher, die neben vielen Artikeln von den wirkungsmächtigen Wortführern verfasst wurden, klang nach der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: «Vom Vergehen und Neuentstehen unserer Gemeinschaft» (Frank Schirrmacher, «FAZ»), «Wir Deutschen» (Matthias Matussek, «Spiegel»), «Die Berliner Republik als Vaterland» (Eckart Fuhr, «Die Welt»), «Weltkrieg um Wohlstand» (Gabor Steingart, «Spiegel»).
Das alles schwankt, mit unterschiedlicher Akzentuierung, zwischen Euphorie und Generalalarm – bald sterben die Deutschen aus, bald sind sie Weltmeister im gelassenen Patriotismus, so wie dem fernsehenden und zeitungslesenden Publikum schon ganz schwummrig werden konnte angesichts der Ausschläge in den publizistischen Nationalprognosen. Hatten in der Endphase der Kanzlerschaft Gerhard Schröders viele Kommentatoren Deutschland ökonomisch und vom Selbstwertgefühl her in der Rangliste der zivilisierten Völker ganz nach hinten durchgereicht, weiss das Land nur zwei Jahre später gar nicht mehr, wohin mit Reichtum, Erfindergeist und überbordender Auftragslage.
Abgrenzungsposen junger Wortführer
Der meinungsführende Journalismus, die Elite der Branche, hat sich jedenfalls in der Berliner Republik im Schwerpunkt in die rechte Mitte bewegt, in die Richtung eines neokonservativen Zentrismus – nicht unbedingt zu verwechseln mit herkömmlichen parteipolitischen Orientierungen an CDU/CSU oder FDP. Die wesentliche Formel dieses Neo-Journalismus ist jener Wahlspruch, den Marschall Pétain für das kollaborierende Frankreich der 1940er Jahre gefunden hatte: travail, famille, patrie – Arbeit, Familie, Vaterland, angereichert heute noch um Gottesfürchtigkeit und Papstbegeisterung. Diese Entwicklung hat mit dem Abgang einer ganzen Generation von prägenden Nachkriegspublizisten und Herausgebern zu tun, mit Posen der Abgrenzung jüngerer Wortführer von allem, was sich politisch und pädagogisch mit 1968 verbinden lässt, mit dem Gefühl von latent bedrohtem deutschem Wohlstand in der Globalisierung, vor allem mit einem politischen Vakuum – es fehlt ein modernes linksliberales Projekt in der handelnden Politik, das auch für den Journalismus sinnstiftend sein könnte.
Rudolf Augstein, Henri Nannen («Stern»), Gerd Bucerius und Marion Gräfin Dönhoff («Zeit»), keine dieser publizistischen Persönlichkeiten kam aus der politischen Linken. Aber das Hamburger Kartell focht, gemeinsam mit der «Süddeutschen Zeitung», der «Frankfurter Rundschau» und Teilen des öffentlichen Rundfunks, für die Anerkennung der Ostgrenzen, für gesellschaftliche Libertinage oder zumindest Toleranz, letztlich für eine sozialliberale Regierung. Zum einen war das linksliberale politisch-publizistische Projekt erfolgreich – die Gesellschaft wurde offener, ziviler, lebendiger; zum anderen wurden Bürokratie und Staatsgläubigkeit bedenklich gefördert.
Auf die publizistischen Gründer der Bonner Republik folgten die Wohlstandsjournalisten aus Berlin-Mitte, die das Erreichte bewahren und verteidigen müssen. Für manche erscheinen in ideologisch volatilen Zeiten das Nationale und die «Schicksalsgemeinschaft» (Schirrmacher) der Deutschen als letzte sichere Ankerplätze, während sonst alle möglichen Kreuz-und-quer-Transfers möglich sind: Die «FAZ» veröffentlicht das neue Buch der Feministin Alice Schwarzer als Vorabdruck, die einst biedere Fernsehillustrierte «HörZu» aus dem Springer-Verlag wirbt ätherisch mit einem sich küssenden Lesbenpärchen, Journalistenwechsel von der «TAZ» zur «Welt» regen kaum noch jemanden auf.
Giovanni di Lorenzo, Chefredaktor der heute bunteren und aufgelockerten «Zeit», wehrt sich gegen den Vorwurf des blutleeren Pragmatismus: «Uns Jüngeren ist die Aufgabe zugekommen, Traditionsblätter zu führen, die ohne massive Eingriffe vermutlich untergegangen wären. Wir haben nicht nur wegen des Einbruchs der Werbemärkte um die Jahrtausendwende in den Abgrund geschaut. Dazu kommen wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Probleme.» Es sei also kein Wunder, dass sich seine Journalistengeneration eher mit pragmatischen Lösungen beschäftige als mit überkommenen Polaritäten.
Rückgriff auf alte Werte
Der Verlust der ideologischen Pole und die mangelnden Bezugspunkte im klassisch-politischen Raum haben für jeden Journalismus, der sich als politisch versteht, zunächst Sinnverlust zur Folge, weil schwerer zu definieren ist, wofür und wogegen geschrieben oder gesendet werden soll. Es wird nach Ersatz gesucht. Der Neo-Journalismus findet ihn im Rückgriff auf die alten bürgerlichen Werte, aber er will im 21. Jahrhundert zugleich trendy und hauptstädtisch hip sein.
So sieht sich auch der Kulturchef des «Spiegels», Matthias Matussek, als Partisan und Verkünder eines deutschen Woodstock-Nationalgefühls. Der Journalismus habe «tatsächlich etwas Guerillamässiges bekommen», sagte er kürzlich in einem Interview; «ich weiss nicht, ob sich das denkerische Niveau unbedingt verbessert hat, aber der Journalismus ist auf alle Fälle lustiger und unterhaltsamer geworden. Das befürworte ich sehr.» In seinem programmatischen Werk «Wir Deutschen» hat Matussek das patriotische Entertainment schon einmal durchdekliniert, indem er «Hitler als Freak-Unfall der Deutschen» definierte, durch Berlin-Mitte gondelte und in seinem Prozess der «Deutschwerdung» lauter völlig gelassene Denker, Galeristen und Party-People traf, aber auch ältere deutsche Zeitgenossen wie Klaus von Dohnanyi mit solchen Fragen löcherte: «Etwa zu welcher Zeit war Deutschland wohl das tollste Land auf Erden? 1790–1800? Um 1300? 1989? In den zwanziger Jahren?»
«Wir Deutschen», findet Matussek, «sind witzig, wir haben Stil, wir haben Heinrich Heine und jenseits des Holocausts eine reiche, stolze Geschichte. Warum mögen wir uns eigentlich nicht?» Hier findet eine Art psychologischer Übertragung vom Autor auf das gesamte Volk statt. Matusseks Wendungen und Kehren sollen unsere Probleme sein. Warum Journalisten nationalerzieherisch zu «lässigem, aber auch prononciertem Patriotismus» aufrufen müssen, bleibt unerfindlich. Journalismus ist, von einer möglichst wahrhaftigen Nachrichtengebung einmal abgesehen, ein säkularer, liberaler, skeptisch-ironischer Beruf. Die Wortführer werden diese historische Identität als Agenten der Aufklärung weiterhin annehmen müssen, wenn sie ihrem Publikum nicht als schwankende Gestalten, suspekt und aufdringlich, erscheinen wollen.
Schlagwörter:Deutschland, Friedrich Sieburg