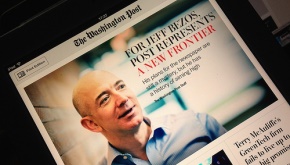Die Darstellung queerer Menschen in afrikanischen Medien ist wegen gesellschaftlicher Einstellungen und politischer, historischer und rechtlicher Rahmenbedingungen nach wie vor ein umstrittenes Thema, das sich stetig weiterentwickelt. Trotz Fortschritten in einigen Regionen sehen sich LGBTQ+-Personen immer noch erheblichen Hindernissen in Bezug auf ihre Sichtbarkeit und Inklusion gegenüber. In diesem Zusammenhang dienen die Medien sowohl als Schauplatz des Widerstands als auch als Instrument der Unterdrückung.

In vielen afrikanischen Ländern sehen sich queere Menschen weiterhin Hindernissen in Bezug auf ihre Sichtbarkeit gegenüber.
Von den 64 Ländern, in denen Homosexualität gesetzlich verboten ist, liegen 50 % in Afrika. Die Folge ist ein feindliches Umfeld für die LGBTQ+-Community in den Medien in vielen Teilen des Kontinents. Selbst in Ländern, in denen gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht ausdrücklich verboten sind, sind queere Menschen weiterhin Vorurteilen, Gewalt und Ausgrenzung ausgesetzt. Solche Länder schränken eine positive Darstellung in den Medien häufig ein, so James Maingi Gathatwa, Margaret Jjuuko und Emanuel Munyarukumbuzi in „‚Kindness Is a Distant and Elusive Reality‘: Charting the Impacts of Discrimination on the Mental and Sexual Wellbeing of LGBT Refugee Youth in Kenya“, einem Kapitel aus Queer and Trans African Mobilities (2022). Das passiert etwa durch Zensur, Einschüchterung in den Redaktionen und das Verbot von Medien, die Homosexualität fördern.
Rechtsorientierte, christlich-fundamentalistische Denkweisen gewinnen weltweit immer mehr an Boden. Das führt dazu, dass viele Länder, darunter Nigeria und Uganda, ihre bestehenden Gesetze gegen Homosexualität verschärft haben und solche wieder eingeführt, die Homosexualität zuvor unter Strafe gestellt hatten. Diese Gesetze sind mit Inhaftierungen, Polizeigewalt, Angriffen durch Bürgerwehren und Diskriminierung am Arbeitsplatz verbunden.
Staatliche Medien übernehmen oft homophobe Narrative
Staatliche Medien in diesen Ländern unterstützen Homophobie und schädliche Stereotypen häufig, indem sie LGBTQ+-Identitäten als „unafrikanisch“ und als Gefahr für kulturelle Werte darstellen. Ein Bericht des Media and Journalism Research Centre, auf den der Press Council of South Africa hinwies, zeigt, dass regierungskontrollierte Medien weltweit dominieren. Über 84 % der staatlich verwalteten Medienunternehmen in 170 Ländern besitzen keine redaktionelle Unabhängigkeit. Diese Tendenz ist auch in vielen afrikanischen Ländern zu beobachten, in denen sich die Positionen der Regierungen häufig in den Medien widerspiegeln. Das geschieht besonders auch im Hinblick auf LGBTQ+-Themen.
Medien in Uganda werden etwa dafür kritisiert, vorurteilsbehaftet zu sein und durch unethische Berichterstattung Homophobie zu verstärken. Die Mainstream-Medien in Kenia wiederholen häufig offizielle Narrative, die die LGBTQ+-Anteile der Bevölkerung als gefährlich oder moralisch verwerflich darstellen. Jjuuko et al. (2022) argumentieren, dass solche Darstellungen zur staatlichen und sozialen Verfolgung queerer Menschen beitragen. Dadurch wird ihnen auch erschwert, Schutz zu suchen oder ihre Rechte geltend zu machen.
Im Gegensatz dazu scheinen südafrikanische Medien die ausgewogensten Ergebnisse in den sechs Parametern der Studie von Brian Pellot zu erzielen, die dieser 2020 für die Arcas Foundation durchführte. Ein großer Teil der Nachrichten konzentriert sich hier jedoch auf die verschiedenen Ebenen der Gewalt, denen diese Minderheit ausgesetzt ist. 61 % der Südafrikaner:innen sind demnach nicht der Meinung, dass Homosexualität von der Gesellschaft akzeptiert werden sollte.
Hoffnung dank unabhängiger digitaler Plattformen
Afrikanische Nachrichtenmedien haben die Möglichkeit, LGBTQ+-Rechte zu unterstützen und Akzeptanz zu fördern, trotz der Schwierigkeiten, die diese Themen überschatten. Gleichzeitig sind unabhängige digitale Plattformen in diesen Ländern zu wichtigen Orten des Widerstands und der Sichtbarkeit geworden, da sie sich dem Medienmonopol ihres Staates entziehen.
Die zunehmende Nutzung digitaler Medien wie TikTok, Instagram oder Podcast-Plattformen bietet neue Möglichkeiten des Ausdrucks. Diese Räume werden für LGBTQ+-Gemeinschaften immer wichtiger, auch, weil sie oft die Gatekeeper der traditionellen Medien umgehen. Online können sie ihre Geschichten teilen, Unterstützung sammeln und für ihre Rechte eintreten.
Queere Migrant:innen im medialen Fokus
Der Zusammenhang zwischen Medien, Migration und queerer Identität in Afrika wird von Jjuuko et al. (2022) hervorgehoben. In ihrer Studie wird untersucht, wie LGBTQ+-Asylsuchende und -Flüchtlinge mit der Medienberichterstattung umgehen. Dabei nutzen sie häufig digitale Plattformen, um den Mainstream-Erzählungen entgegenzuwirken. In Kenia beispielsweise, wo LGBTQ+-Flüchtlinge systematischer Diskriminierung ausgesetzt sind, haben Online-Medien eine entscheidende Rolle dabei gespielt, ihre Probleme zu dokumentieren und internationale Unterstützung zu suchen.
Durch digitales Storytelling und Lobbyarbeit können die Medien queere Gemeinschaften dabei unterstützen, sich für eine inklusivere Darstellung und politische Reformen einzusetzen. Mit dieser Einstellung und unter Einhaltung ethischer Standards im Journalismus können Mainstream-Medien entscheidend dazu beitragen, Mythen zu zerstreuen und feindselige öffentliche Wahrnehmungen zu verändern.
Trotz Verbesserungen in bestimmten Bereichen gibt es noch viele Hindernisse zu überwinden, insbesondere in Ländern, in denen Homosexualität illegal ist und negative Wahrnehmungen durch die Medien verstärkt werden. Medien haben die Möglichkeit, durch die konsequente Einhaltung ethischer journalistischer Praktiken und die Nutzung neuer digitaler Plattformen zu einer offeneren, integrativeren Gesellschaft auf dem gesamten afrikanischen Kontinent beizutragen.
Dieser Beitrag wurde zum ersten Mal am 11.02.2025 auf der Webseite des African Journalism Education Network veröffentlicht. Übersetzt von Judith Odenthal mithilfe von DeepL.
Schlagwörter:Inklusion, Journalismus in Afrika, LGBTQ