Über EU-Angelegenheiten berichten, das bedeutet, komplexe Themen und Strukturen aus einem internationalen Kontext für verschiedene lokale Publika verständlich aufzubereiten. In seinem kürzlich erschienenen Handbuch teilt der langjährige EU-Korrespondent Michael Grytz Wissen zu Theorie und Praxis des EU-Journalismus. In den 28 Kapiteln geben Grytz und Kolleg:innen von verschiedenen Medien Einblick in ihre Arbeit und tragen ihre Erfahrungen zusammen. Im Interview mit dem EJO erzählt Michael Grytz, warum dieses Buch so wichtig ist, was den Arbeitsplatz Brüssel besonders macht und was er der nächsten Generation von EU-Journalisten mit auf den Weg geben möchte.

Michael Grytz war zweimal als WDR-Korrespondent in Brüssel, wo er unter anderem den „Bericht aus Brüssel“ entwickelte und gestaltete: Von 2001 bis 2006 und dann wieder von 2016 bis 2023. Foto: privat
Johanna Mack: In einem Satz: Warum brauchte es dieses Handbuch über EU-Berichterstattung?
Michael Grytz: Der erste Punkt war, dass ich 13 Jahre in Brüssel gearbeitet habe, eine politische Europasendung aufgebaut habe, aber nicht nur in Brüssel, sondern auch in meiner Zeit in der Wirtschaftsredaktion beim WDR in Köln war die EU Dauerthema. Damals erschütterte die Banken-, Euro- und Finanzkrise die Welt und natürlich auch die EU. Daher hat mich dieses Thema sehr, sehr lange begleitet. Zweitens stellte ich nach meiner Rückkehr aus Brüssel fest, dass es dazu bisher keine Veröffentlichung gab – jedenfalls keine so praxisorientierte. Die wenigen Veröffentlichungen, die es gab, schienen nicht mehr aktuell.
Und drittens, nachdem ich die ersten Kapitel grob durchdacht hatte, war mir klar, dass ich auf keinen Fall meine alleinigen Überlegungen zusammenfassen möchte, sondern auch andere Kollegen befragen will. Ich bin sehr dankbar, dass nun 14 Kollegen aus dem Umfeld Brüssels von der Financial Times, über die Frankfurter Allgemeine Zeitung, über die Welt, den Deutschlandfunk bis hin zu Politico, also alle, die gelesen werden und in Brüssel das Geschehen sehr gut kennen, mir Beiträge mit sehr wertvollen Erkenntnissen zugeliefert haben.
Was unterscheidet denn die Berichterstattung über EU-Politik aus Brüssel von innenpolitischer Berichterstattung?
Bei uns in Deutschland betreiben wir ziemlich viel Nabelschau. In Brüssel lernt man schnell, dass auch andere Dinge eine Rolle spielen, und da geht es vor allem um die Interessen auch der anderen Mitgliedstaaten. Dass es wichtig ist, zu wissen, wer ein kleiner und wer ein großer Mitgliedstaat ist, wer Einfluss hat und wer nicht, wer wie auf Deutschland schaut oder sich von Deutschland abgrenzt und dass all dies zu der Entscheidungsfindung mit beiträgt.
Wenn man in der deutschen Landschaft berichtet, berücksichtigt man nicht immer in der ganzen Tiefe, welche Strukturen hinter einer bestimmten Entscheidung eigentlich stecken.
Ein Beispiel: Das Verbrenner-Aus wurde im letzten Jahr ein Riesenthema. Dass aber schon seit ein paar Jahren alle Mitgliedstaaten, auch die Deutschen, die Abgeordneten im Europaparlament und viele andere Gruppen damit beschäftigt waren, das zu umzusetzen, spielte so gar keine Rolle mehr. Stattdessen wird gefragt, wie kann das nur sein, dass Brüssel sowas verabschiedet? Dass aber alle Beteiligten seit Jahren daran gearbeitet haben und dann zu diesem Ergebnis gekommen sind, war kaum noch ein Thema.
Der Unterschied ist für mich, dass man aus Brüsseler Perspektive mit mehr Tiefe und Verständnis an solche Entscheidungsprozesse herangeht und alles in einem größeren Rahmen zu sehen lernt. Und dennoch berichten EU-Korrespondenten vielfach aus ihrer nationalen Perspektive, auch weil das vielfach von ihren Redaktionen verlangt wird.
Deswegen habe ich in dem Buch auch die Frage aufgeworfen, ob es so etwas wie einen europäischen Journalismus gibt oder ist der EU-Korrespondentenjob eigentlich nur eine aus Deutschland verlagerte Redaktionsstelle von Berlin nach Brüssel? Meine Anregung ist, mehr über diese Perspektive nachzudenken.
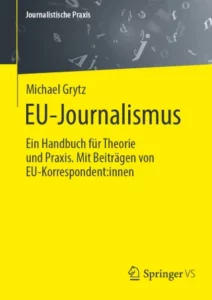
Und zu welchem Ergebnis kommen Sie? Gibt es, Ihrer Erfahrung nach, eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit bzw. einen europäischen EU-Journalismus, oder herrschen die nationalen Perspektiven vor?
Ich habe erlebt, dass die nationalen Perspektiven in der Berichterstattung oft vorherrschen. Meist wollen Redaktionen deutsche Stimmen hören. Bei der letzten Europawahl wollte in Deutschland kaum jemand etwas über den sozialistischen Spitzenkandidaten für die EU-Kommission aus Luxemburg hören. Stattdessen wollte man Katarina Barley, die gar keine Spitzenkandidatin war, jedenfalls nicht für den Posten der Kommissionspräsidentin. Die realität in Brüssel aber ist, daß dort keine Entscheidung fällt, ohne alle nationalen Perspektiven mit einzubeziehen. Bei großen und wichtigen Entscheidungen geht es immer darum, einen größtmöglichen Konsens herzustellen. Frau von der Leyen ist ja auch keine Regierungschefin, die irgendetwas entscheidet. Die Kommission kann nichts entscheiden, ohne dass EU-Mitglieder, die Staats- und Regierungschefs bzw. die zuständigen Minister und überdies noch das Europaparlament mitgewirkt haben. Ich glaube, dass da in der Öffentlichkeit das Bild ein bisschen schräg ist und einige Missverständnisse existieren.
Ohne die Staats- und Regierungschefs bzw. dem Einverständnis der Mitgliedstaaten läuft letztendlich nichts. Aber alle Entscheidungen sind letztlich das Ergebnis eines sehr, sehr aufwändigen Konsensfindungsprozesses. Deswegen stelle ich in dem Buch die zentrale These auf, dass man bei der Betrachtung europäischer Politikprozesse immer auch einen gewissen Kompromissfaktor berücksichtigen sollte. Die Bewertung solcher Prozesse sollte also nicht dem Muster folgen: Drei Tage gestritten, uneinig und jetzt irgendeine halbgare Lösung, mal zuspitzt gesagt. In der Realität geht es um starke Interessens- und Meinungsunterschiede und lange Diskurse, die miteinander zu Ergebnissen finden müssen. Unter den Bedingungen, unter denen dort Politik gemacht werden muss, ist es vielleicht schon ein gutes Ergebnis, wenn man gemeinsam zu einer Entscheidung gekommen ist, die alle Bedürfnisse und Interessen einigermaßen gleichsam berücksichtigt.
Weil das so kompliziert ist, fordern viele, die Einstimmigkeit bzw. Vetomöglichkeiten abzuschaffen. Doch die Forderung ist wohlfeil, in der Brüssel-Bubble ist der Applaus sicher, nur, man kann das Veto nicht einfach abschaffen, denn es bedarf dafür eines einstimmigen Beschlusses. Und irgendwer wird immer ein Veto gegen die Abschaffung des Vetos einlegen. Österreich und andere kleine Länder werden sich immer diese Option offenhalten weil sie natürlich die Sorge haben, dass sie sonst von den Großen überrannt werden. Also behalten sie sich hier so eine Art Vetorecht vor. Damit muss man leben.
Sie haben erwähnt, dass es oft um sehr komplexe Strukturen geht, über die viele der Nutzenden vielleicht nicht in aller Tiefe Bescheid wissen. Wie schafft man es, das für das Publikum greifbar zu machen? Auch Stichwort Fachsprache.
Das ist die Frage der Fragen, wenn man in Brüssel arbeitet. Und diese Frage ist besonders schwierig für jemanden zu beantworten, der für alle da sein muss. Wenn ich Handelsblatt- oder FAZ-Korrespondent bin, dann habe ich natürlich eine bestimmte Klientel, die ist etwas stärker abgegrenzt, außerdem hat man mehr Platz. Wer fürs Fernsehen und erst recht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, der muss ein breiteres Publikum bedienen, alle müssen es verstehen und für alle muss es einen Mehrwert haben. Da ist es ungleich schwieriger, den richtigen Weg zu finden, zumal man oft nur wenig Platz für die Berichterstattung hat.
Dem habe ich auch ein Kapitel unter dem Stichwort Darstellungsformen gewidmet. Ein wichtiger Hinweis ist, über den Tellerrand zu sehen, mehrere Perspektiven auf ein Thema zu beleuchten Wir haben zum Beispiel im Europa-Magazin in der ARD eine Reihe unter dem Titel #Wo steht Deutschland? entwickelt. Da setzen wir Deutschland in ein Ranking und überprüfen z.B., wie reich sind eigentlich die Deutschen? Wo steht Deutschland im europäischen Vergleicht? Kaum jemand hätte geglaubt, dass Belgien ganz weit oben steht beim privaten Vermögen der Menschen, auch der 18-Jährigen beispielsweise. Ein anderes Beispiel ist die Jugendarbeitslosigkeit. Durch solche Vergleiche setzt man sich nicht nur ins Verhältnis und korrigiert manches Vorurteil, sondern man zeigt die Gründe auf, warum die Dinge so sind und mit welcher Politik die Länder dem begegnen. Best-Practice: Was kann man lernen von anderen?
Ich schlage vor, immer auch aus der anderen Perspektive zu denken. Im Buch gibt es ein etwas provozierendes Beispiel: Irland hatte sich in manchen Bereichen als Niedrigsteuerland positioniert. In der Folge gab einen Streit um Firmen wie Apple, die praktisch kaum Steuern zahlten, was viele als Wettbewerbsverzerrung einschätzten und die EU-Kommission dazu brachte, dagegen vorzugehen. Ich argumentiere: Irland ist ein kleines Land und hat im ökonomischen Standortwettbewerb nicht sehr viele Vorteile, außer vielleicht, dass es ein wunderbares Urlaubsziel ist mit einer sehr angenehmen Bevölkerung. Aber industriell war es eher schwierig. Deswegen gehörte Irland auch lange zum Armenhaus der Europäischen Union. Heute sehen wir, dass das Land unheimlich prosperiert und sich an die Spitze gesetzt hat. Es hat seine Vorteile genutzt auch dank niedriger Steuersätze siedelten sich viele Tech-Unternehmen dort an. Das haben andere Länder mit großem Ärger wahrgenommen. Nun musste das Land rein wettbewerbsrechtlich schließlich nachgeben müssen, es aber geschafft, weiterhin attraktiv zu bleiben, der wirtschaftliche Vorteile brachte und junge Menschen anzieht. Mittlerweile hat Irland eine der jüngsten Bevölkerungen in der EU und ist aus den Schulden rausgekommen. Und zwar aus eigener Kraft. Kann man denen das zum Vorwurf machen?
Eine weitere zentrale Frage für die Berichterstattung ist, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und diese Frage sollte man sich zunächst vom User, vom Publikum aus stellen.
Einige Kapitel in dem Buch beschäftigen sich mit der Arbeitsweise von EU-Korrespondent:innen, z.B. dem Phänomen ‚High Noon‘ oder auch dem Bedarf an guten Netzrzwerken aus Expert:innen. Gibt es Tagesabläufe oder auch Fähigkeiten, die für EU-Korrespondent:innen besonders sind?
Die Angebote sind sehr unterschiedlich geworden. Es ist ein 24-7-Betrieb geworden. Bei den Politico-Redakteuren fängt der Tag sicher sehr früh an, da sie bis 7 Uhr ihr Daily Brussels Playbook veröffentlichen wollen. Dann lesen das alle anderen Journalisten und auch die Beamten in der Kommission, damit sie für die Diskussionen um 9 Uhr in ihrer Runde gewappnet sind. Radiokollegen haben bis dahin schon längst Beiträge veröffentlicht, während wir beim Fernsehen meist erst um 10, 1030 so richtig angefangen haben, weil unsere Primetimes eher abends sind. Insofern haben sich die Regulatorien ein bisschen verändert – das war vor 15 Jahren noch anders, als wir noch nicht so getrieben waren durch Social Media und das Internet.
Am Vormittag ist, grob gesagt, Zeit für Recherche. 12 Uhr ist für viele ein Fixpunkt, weil dann das Kommissionsbriefing stattfindet. Vorher und nachher gibt es immer wieder technische Briefings. Über den Tag verteilt finden zahlreiche Hintergrundgespräche statt. Am Nachmittag fertigen viele unterschiedliche Beiträge, sei es für das Fernsehen oder die Zeitungsausgaben. Am Abend stehen dann Meetings auf dem Programm, sei es in den ständigen Vertretungen der Bundesländer, Hintergrundabende bei Abgeordneten oder Informationsveranstaltungen von Branchen oder Unternehmen. In Brüssel zu arbeiten bedeutet, lange tage zu haben und viele Abende erst spät nach Hause zu kommen.
Sie haben Politico erwähnt. In der Beschreibung eines Buchkapitels heißt es: “like it or not, it’s the 28th member state”, im Titel des Kapitels wird Politico die ‘Bible of EU Affairs’ genannt. Warum diese immense Bedeutung? Wie kam es dazu?
Auch wenn die Bedeutung da vielleicht etwas übertrieben ist – man muss schon sagen, alle in Brüssel lesen morgens Politico. Die betreiben auch Agenda-Setting. Das hat es früher in der Form nicht gegeben. Zudem hat Politico relativ viele Leute, die von morgens bis abends arbeiten und sehr nah an den Ereignissen sind. Keine andere Redaktion macht das so umfassend und so tief.
Hinzukommt, Politico betreibt ja sowas wie europäischen Journalismus mit weitem Blick auch auf andere Länder. Das ist natürlich für die anderen Journalisten und Korrespondenten sehr interessant. Deshalb ist es eine sehr wichtige und interessante Lektüre für alle geworden, nicht nur für die anderen Medien, sondern eben auch für die Entscheidungsträger.
Welche Entwicklungen in der EU, glauben Sie, werden die Berichterstattung aus Brüssel in den kommenden Jahren besonders prägen?
Da gibt es zwei Aspekte: den binneneuropäischen und den geopolitischen. Fangen wir mit dem zweiten an. Wir alle haben ja in der letzten Zeit erlebt, dass wir als Europäer eher schwach sind, abhängig von anderen Kontinenten, verteidigungspolitisch nicht so gut aufgestellt. Vor ein paar Jahren haben wir das alles nicht so dramatisch gesehen und merken jetzt auf einmal, dass wir da nicht einfach Schnipp machen können und dann ist alles wieder top.
Dann kommt da ein amerikanischer Präsident, der an Europa nur insofern interessiert ist, als dass er es spalten will und dass Europa möglichst viel zahlt. Und der sagt, naja, wenn ihr das mit den Zöllen nicht hinnehmen wollt, dann gebe ich auch nichts mehr für die Verteidigung der Ukraine. Er verknüpft diese Sachen einfach. Und das hatte Europa vorher nicht auf der Rechnung.
Die geopolitische Schwäche Europas, steht in einem krassen Widerspruch zum eigenen Anspruch, den man sich lange selbst zugeschrieben hat und der Rolle, die man spielen wollte.
Inneneuropäisch wiederum gab es immer die Idee, dass Europa immer integrativer werden und zusammenwachsen muss. Das war sogar bei der letzten Bundesregierung ein wichtiger Teil des Koalitionsvertrages. Auch im Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steht geschrieben, dass wir als Journalisten die Integration Europas fördern sollen. Es ist eine Art Common Sense gewesen, dass ein Europa, das immer stärker zusammenwächst, eigentlich das Ziel ist.
In den letzten Jahren musste man dann schmerzlich feststellen, dass es viele Länder gibt, die das gar nicht in der Form wollen. Die wollen eher, dass der Zusammenhalt etwas loser ist. Man hat das eine lange Zeit damit übertüncht, dass Viktor Orban aus ganz anderen Gründen so eine Art EU-Outlaw geworden ist. Dabei sagt er klipp und klar und viele Ungarn sehen das auch so: wir sind jahrzehntelang von den Habsburgern dominiert worden; dann von den Nazis und dann von Moskau. Wir lassen jetzt nicht zu, dass wir aus Brüssel oder der Kommission dominiert werden. Das ist vielleicht etwas zugespitzt, aber man muss, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, dass es einige Länder gibt, die sagen, das ist uns alles zu viel mit dem Europa, das viele in Brüssel vorantreiben wollen.
Aber Herfried Münkler geht in einigen Interviews sogar so weit, dass je stärker das Ganze zusammenwächst, auch die Fliehkräfte an den Rändern möglicherweise größer werden. Das heißt, dass sich diese Entwicklungen gegeneinseitig auch bedingen. Und das müssen wir jetzt schmerzlich erkennen, dass also diese Brüsseler Bubble, die glaubt, die immer bessere Integration muss das große Ziel sein und sie sei ohne Fehl und Tadel, dass das so ohne weiteres nicht funktioniert.
Ich bin allerdings zu einer Erkenntnis gekommen: Ich kenne keine Alternative zur Europäischen Union und der intensiven Zusammenarbeit. Wer sie kennt, soll sie mir nennen. Wenn ich mir überlege, dass wir jetzt als Deutsche, als Franzosen oder als Österreicher allein und jeder für sich mit Trump, Putin oder Xi reden sollen, das scheint mir nun wirklich keine Option zu sein.
Man kann sich über lange und vielstimmige Gipfeltreffen trefflich amüsieren oder aufregen; oder über Streit und Uneinigkeit. Aber man stelle sich nur eine Sekunde vor, was wäre, wenn diese Treffen nicht stattfinden würden, wenn wir nicht zusammenarbeiten würden, wenn wir uns nicht austauschen würden.
Also, das wäre doch ein Rückschritt, über den möchte ich gar nicht nachdenken. Das heißt, es gibt für mich keine Alternative. Dass sich allerdings die Europäische Union intern verändern muss, das ist für mich persönlich auch ganz klar. Das hätte eigentlich sogar spätestens mit dem Brexit passieren müssen. Und das ist leider ein Manko, da sind viele offene Baustellen.
Haben Sie einen Wunsch an die nächste Generation von EU-Korrespondent:innen, oder eine Empfehlung, die Sie ihnen mitgeben möchten?
Das erste ist, sich selbst immer wieder zu spiegeln und in Frage zu stellen. Das eigene Weltbild nicht zur Grundlage der Berichterstattung zu machen. Ich habe mich in dem Buch auch auf eine Studie der TU Dortmund von Michael Steinbrecher bezogen, wo es um Demokratie und Journalismus geht. Und ich war dann doch erschrocken, wie viele Journalisten sich offen bekannt zu einer ganz bestimmten politischen Richtung bekannt haben. Ich finde, man muss sich schon darüber bewusst sein, wenn man zum Beispiel eine Sympathie für die Grünen hat, dass das die kritische Berichterstattung über den Green Deal nicht beeinflussen darf.
Ich empfehle auch, Standards zu überprüfen. Immer wenn man glaubt, man sei sich sicher, wie alles einzuschätzen ist, muss spätestens der Moment kommen, an dem man noch einmal von hinten denkt und sein eigenes Urteil überprüft. Die Welt ist größer als das, was wir vorfinden oder wovon wir glauben, dass es richtig oder wichtig ist.
Der andere Punkt ist, ein Stück weit die nationale Brille abzusetzen und die größeren Zusammenhänge zu sehen. Nur weil uns manche Personen oder Abläufe uns vielleicht nicht gefallen mögen, sollte man darüber nachdenken, ob sie nicht doch Kern haben, der sinnvoll ist.
Narrative hinterfragen, genauer hinschauen, kritisch nicht nur in der Sache, sondern auch mit sich selbst und den eigenen Fragestellungen zu bleiben, das gehört meines Erachtens – neben den üblichen Standards – unbedingt dazu.
Schlagwörter:Brüssel, EU, EU-Berichterstattung, Europäische Union, Handbuch





















