- 22Shares
- Facebook21
- E-mail1
- Buffer
Es braucht ein Zweck-Bündnis von Journalismus und Wissenschaft, eine „Allianz für die Aufklärung“.
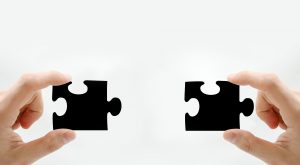 Zwei Systeme haben bislang die kollektive Vernunft der Öffentlichkeit gespeist, wenn es diese denn je gegeben haben sollte: der Journalismus, soweit er auf Seriosität bedacht ist, und die Wissenschaft. Beide Systeme sind durch jüngste Fehlentwicklungen, durch die ungehemmte Verbreitung von Desinformation, aber auch durch proliferierenden Populismus und Autokratismus gefährdet – obschon sie für die Demokratie, die Marktwirtschaft und für eine freiheitliche Gesellschaft unverzichtbare Leistungen erbringen.
Zwei Systeme haben bislang die kollektive Vernunft der Öffentlichkeit gespeist, wenn es diese denn je gegeben haben sollte: der Journalismus, soweit er auf Seriosität bedacht ist, und die Wissenschaft. Beide Systeme sind durch jüngste Fehlentwicklungen, durch die ungehemmte Verbreitung von Desinformation, aber auch durch proliferierenden Populismus und Autokratismus gefährdet – obschon sie für die Demokratie, die Marktwirtschaft und für eine freiheitliche Gesellschaft unverzichtbare Leistungen erbringen.
Journalisten und Wissenschaftler sollten sich deshalb im Kampf gegen Desinformation und für Wissenschafts- und Pressefreiheit sowie für eine zivilgesellschaftlich „verträgliche“ Meinungsfreiheit stärker engagieren. Die Frage drängt sich geradezu auf: Könnten sie sogar ein Zweckbündnis, eine „Allianz für die Aufklärung“, schmieden, um gemeinsam gegen Desinformation vorzugehen, wie soeben neuerlich von den „Siggener Impulsen“ gefordert?
Die Win-win Strategie: Kräfte bündeln
Auf den ersten Blick erscheint es naheliegend, die Kräfte derer zu bündeln, die sich in besonderer Weise der Rationalität verschrieben haben. Aber es gilt vorab auch ein fundamentales Missverständnis auszuräumen, das im bisherigen Diskurs Heike Blattmann und auch Reiner Korbmann genährt haben: Eine Allianz ist und bleibt ein begrenztes Zweckbündnis, von dem beide Seiten profitieren. Es geht nicht darum, Journalismus und Wissenschaft „ehelich“ zu verbandeln und unter dieselbe Bettdecke zu stecken.
Wie die Allianz im Detail auszugestalten wäre, kann nicht Gegenstand dieses Beitrags sein. Im Kern ginge es darum, Anreizsysteme zu verändern, damit
- Journalisten vermehrt auf wissenschaftliche Quellen zurückgreifen und
- Forscher häufiger den Elfenbeinturm verlassen.
Dann könnten Medien über komplexe Themen angemessen berichten, statt Unsinn zu verbreiten, mit dem sie vielfach von dritter Seite gefüttert werden. Die Forscher würden in den Medien mit ihrer fachlichen Kompetenz und ihrer verstärkten Präsenz der Desinformation entgegenwirken.
So manche Forscher scheinen sich immerhin darauf zurückbesinnen, dass Wissenschaft nicht losgelöst von der Gesellschaft, sondern nur „eingebettet“ in sie ihren Ort finden kann. Die Steuerzahler finanzieren weitgehend die Grundlagenforschung. Schon deshalb haben sie ein Recht zu erfahren, was mit ihrem Geld passiert – aber dazu braucht es nicht nur gesprächsbereite Wissenschaftler, sondern weiterhin den Journalismus, insbesondere den Wissenschaftsjournalismus, und zwar nicht nur als Transmissionsriemen, sondern auch als Watchdog und Korrektiv des Forschungsbetriebs.
Gegenläufige Trends: Professionalisierung versus Prekarisierung
Erheblichen Einfluss auf die Bereitschaft zum Engagement dürften allerdings zwei Trends haben, die sowohl im Journalismus als auch in den Wissenschaften durchschlagen: Professionalisierung und Prekarisierung. Erstere ist im Journalismus über einige Jahrzehnte hinweg vorangekommen, wurde aber in den letzten Jahren von der ökonomischen Entwicklung in der Medienbranche ausgebremst. Fortschreitende Professionalisierung hat stärker als früher zu einem Grundkonsens über journalistische Spielregeln beigetragen.
Die gegenläufige Prekarisierung, die in den Redaktionen vor ein paar Jahren mit dem rapiden Abbau von festen Stellen, dem dramatischen Honorarverfall bei freien Mitarbeitern und der inflationären Vermehrung unbezahlter Praktikumsplätze begann, wirkt ebenfalls zurück – vor allem auf die Möglichkeiten, zeitaufwändig im Wissenschaftsbetrieb zu recherchieren, aber auch auf die Bereitschaft von Journalisten, sich zu exponieren.
Absurde Kriterien der Leistungsmessung im Wissenschaftsbetrieb
Für Wissenschaftler lassen sich ähnliche Tendenzen der Professionalisierung und Prekarisierung konstatieren: Einerseits haben Spezialisierung und Leistungsdruck dramatisch zugenommen: Das System des Peer review, gepaart mit der Erwartung, möglichst früh viele Drittmittel einzuwerben und möglichst viel in angelsächsischen Fachzeitschriften zu publizieren („Publish or perish“), begünstigen Fachidiotentum. Erarbeitete Forschungsergebnisse werden inzwischen eher auf drei Fachzeitschriftenbeiträge aufgesplittet als in einen größeren Zusammenhang gestellt, denn für die Zusammenschau wissenschaftlicher Erkenntnisse lassen sich kaum irgendwo Forschungsgelder einwerben, und drei Publikationen machen in der Liste der eigenen Veröffentlichungen eben mehr her als eine. Was fehlt, ist der Überblick: Schon 1982 beklagte der Biochemiker Erwin Chargaff die vielen wissenschaftlichen Tiefbohrungen ohne Querverbindungen.
Eigentlich gehören zu produktiver Forschung auch Differenzen, Dissense, Diskurse, gelegentlich auch widersprüchliche Erkenntnisse. Was die Essenz wissenschaftlichen Arbeitens und wissenschaftlichen Fortschritts ausmacht, wird jedoch inzwischen – auch aus Prekarisierungsangst gerade junger Forscher – vielfach unter den Tisch gekehrt.
Professionalisierung wie Prekarisierung stehen also der Allianz von Forschern und Journalisten eher im Weg. Das gilt auch für widersprüchliche Erwartungen. „Normalmenschen“, darunter viele Journalisten, erhoffen sich von der Wissenschaft Eindeutigkeit. Sie soll politischen Streit im Namen von Rationalität und Aufklärung schlichten, und genau das kann sie oftmals nicht.
Darüber hinaus geht es vielen Journalisten geht es auf der Suche nach Experten vorrangig gar nicht um Wahrheitsfindung, sondern um etwas, was Hans Mathias Kepplinger „instrumentelle Aktualisierung“ genannt hat: Oft versuchen sie, einen Forscher einzuspannen, dessen Aussage sich schon vorher abschätzen lässt. Und gerade die medienerfahrenen Wissenschaftler spielen solchen Journalisten oftmals in die Hände. So mancher von ihnen liefert das Gewünschte und überschreitet dabei leichtsinnig seine Kompetenzgrenzen. Er schadet so seiner Scientific Community, weil er damit den Kredit und die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft in der Öffentlichkeit verspielt.
Auch das hilft zu erklären, warum nur wenige Forscher ins Rampenlicht drängen und sich der Medienmaschinerie ausliefern, um heroisch um Aufklärung zu kämpfen. Das Risiko, Reputation durch mediale Aufmerksamkeit zu verspielen, gibt es weiterhin. Obendrein lässt sich im Blick auf die eigenen Karrierechancen kein Blumentopf gewinnen – solange jedenfalls nicht, wie Forschungsförderungs-Institutionen bei der Mittelvergabe Medienpräsenz kaum explizit honorieren.
Das Kooperationspotential – realistisch eingeschätzt
Diesen Circulus vitiosus gälte es, zu durchbrechen. Vieles könnte in der Wissenschaftskommunikation anders sein. Wie lässt sich in einer digitalisierten und medial konvergenten Welt Wissenschaft kommunizieren? Was können wir – insbesondere jeder einzelne Forscher, jeder einzelne Journalist – ganz praktisch tun?
Eigentlich geht es um die perfekte Win-win-Situation: Journalisten könnten bei ihren Recherchen die nahezu unerschöpflichen, wenn auch nicht immer leicht zugänglichen Ressourcen des Wissenschaftsbetriebs angemessen nutzen. Sie bekämen Information, die meist verlässlich ist, Stoff für Stories. Wissenschaftler hätten umgekehrt die Chance, ihr Wissen mit Journalisten und der Öffentlichkeit zu teilen. Sie erhielten öffentliche Aufmerksamkeit, die sich bei seriöser journalistischer Berichterstattung eben doch in Reputations-Zugewinn ummünzen lässt.
Wissenschaftler müssten allerdings akzeptieren, dass Journalisten ihre Arbeit hinterfragen. Der Karlsruher Philosoph Helmut Spinner hat dazu in den 80er Jahren das Nötige gesagt. Er wies darauf hinwies, dass der „findige“ Wissenschaftsjournalist „eigenständige Erkenntnisarbeit in problemlösender Absicht“ leiste und „weder Kumpan noch Konkurrent des Wissenschaftlers“ sei, „sondern dessen funktionelles Komplement, das die Informationslage um Beiträge ergänzt, welche die Wissenschaft nicht erbringen und die Wissensgesellschaft nicht entbehren kann“.
Es geht also um eine Verbundenheit in kritischer Distanz: Gemeinsames Interesse an der Wahrheitssuche, aber auch klar definierte Rollenabgrenzung – und auf beiden Seiten das Wissen darum, dass man aufeinander angewiesen ist, wenn die eigene Arbeit verbessert oder wirkungsvoller ausgestaltet werden soll. Beide Seiten müssten sich aber auch in die Karten gucken lassen und sich wechselseitig kontrollieren, um auf Fehlentwicklungen im jeweils anderen System aufmerksam zu machen.
Solch ein Wissenschaftsjournalismus, der Distanz zum Forschungsbetrieb wahrt und trotzdem Brücken zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft baut, kommt uns mehr und mehr abhanden. Er wurde zunehmend durch Wissenschafts-PR ersetzt, der das Mediensystem mit „guten“ Nachrichten aus der Forschung, mit oftmals aufgepeppter „Science light“ versorgt und „kolonisiert“, statt den Forschungsbetrieb zu durchleuchten. Dabei gehörte es natürlich von Journalisten aufgedeckt, wenn in der Wissenschaft Gravierendes schiefläuft.
Voraussetzung für Glaubwürdigkeits-Rückgewinn von Journalismus und Wissenschaft wäre nicht zuletzt, dass sich auf beiden Seiten die Akteure von den schwarzen Schafen in den eigenen Reihen mutiger abgrenzen. Denn diese untergraben von innen heraus das Vertrauen in beide Institutionen. Da bekanntlich eine Krähe der anderen kein Auge auskratzt, also realistischerweise weder vom Journalismus noch von der Wissenschaft zu erwarten ist, dass sie im Übermass Selbstreinigungskräfte mobilisieren werden, sind beide Systeme an diesem Punkt auf Gegenseitigkeit gefordert: Die Medienforschung hätte (im Verbund mit der „fünften Gewalt“, einem funktionierenden Medienjournalismus), dafür zu sorgen, dass der Journalismus „clean“ gehalten wird. Der (Wissenschafts-)Journalismus hätte weitaus grössere Anstrengungen zu unternehmen, um im Forschungsbetrieb in ähnlicher Weise eine Kontrollfunktion als „Fourth estate“ auszuüben, wie er sie noch immer gegenüber Politik und Wirtschaft wahrnimmt, wenn auch dort unvollkommen und in schrumpfendem Umfang.
Netzwerke und Selbstorganisation als Chance
Fassen wir zusammen: Insgesamt geben die skizzierten Rahmenbedingungen keinen Anlass für allzu großen Optimismus im Blick auf eine gemeinsame Mobilisierung von Ressourcen beider Systeme zur Desinformationsbekämpfung. Fakt ist, dass die Eigendynamik des Journalismus und der Wissenschaft sich eher in Richtungen bewegt, die die Schnittmenge der Gemeinsamkeiten kleiner werden lässt: Mars und Venus sind in unterschiedlichen Umlaufbahnen unterwegs.
Andererseits lässt sich informell Kooperation mithilfe der sozialen Netzwerke viel leichter als früher organisieren. Es bedarf nicht mehr großer Organisationsgewalt, weil ja dank der Plattformen, also zum Beispiel Facebook und Twitter, LinkedIn und Researchgate, jeder einzelne Journalist und jeder einzelne Wissenschaftler dezentral sein eigenes Netzwerk aufbauen und pflegen kann.
Es hat im Lauf der Jahre wiederholt Versuche gegeben, mehr Zusammenarbeit zwischen Journalismus und Wissenschaft zu fördern – angefangen bei Förderprogrammen für den Wissenschaftsjournalismus verschiedener Stiftungen bis hin zu jüngsten Initiativen wie das Science Media Center in Köln, das Journalisten bei der Recherche mit wissenschaftlichem Sachverstand unterstützt, oder dem von mir mitgegründeten, inzwischen 13-sprachigen Netzwerk des European Journalism Observatory, das Erkenntnisse der Medienforschung an die Medienpraxis heranträgt und zugleich Brücken zwischen den Journalismus-Kulturen Europas baut. Wie zäh solche Initiativen vorankommen, ist eher entmutigend.
Käme die angedachte „Allianz für die Aufklärung“ dennoch zustande, wäre sie auch ein Bündnis des Gemeinsinns. Forscher und Journalisten würden ihre Ressourcen poolen und sich wechselseitig unterstützen. Beide Seiten würden etwas mehr von ihrer knappen Zeit dem Service public widmen, um gemeinsam ein hohes gesellschaftliches Gut zu verteidigen: unser aller Recht auf wissenschaftliches Wissen und wissenschaftlichen Fortschritt, aber auch auf stimmige, journalistisch geprüfte Information und zutreffende Nachrichten.
Der Beitrag ist ein aktualisierter und stark verkürzter Auszug aus dem Buch „Die informierte Gesellschaft und ihrer Feinde. Warum die Digitalisierung die Demokratie gefährdet“ (Köln, Herbert von Halem Verlag 2017.
Erstveröffentlichung: Wissenschaft kommuniziert vom 30. Januar 2019
Bildquelle: pixabay.com
- 22Shares
- Facebook21
- E-mail1
- Buffer
Schlagwörter:Allianz für die Aufklärung, Desinformation, Journalismus, Prekarisierung, Professionalisierung, Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation



















