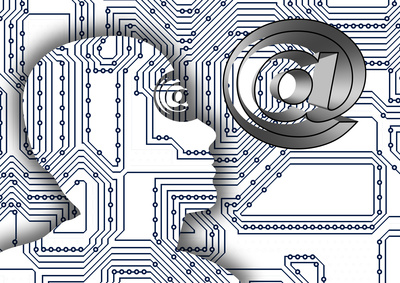- 13Shares
- Facebook13
- Buffer
Wir brauchen eine klare Haltung, um gegen Entrüstungen zu schwimmen und freie Sicht auf wirklich drängende Probleme zu behalten.

Eine Satire des Liedes „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ hat eine Welle der Empörung ausgelöst – die Massivität der Empörung und die Art der Reaktionen offenbaren Abgründe.
Vorweggesagt: Geschmäcker sind verschieden. Zeilen wie „Meine Oma brät sich jeden Tag ein Kotelett, ein Kotelett, ein Kotelett, weil Discounterfleisch so gut wie gar nix kostet. Meine Oma ist ’ne alte Umweltsau“ kann man als lustige Satire sehen, albern oder blöd finden, als Anstoß zur Diskussion betrachten oder als Lappalie.
Aber es liefert ein düsteres Bild der Großwetterlage unserer Gesellschaft, welche Reaktionen dieses im Sinne der Umweltfrevel der Generation ihrer Großeltern umgedichtete, von einem Kinderchor fröhlich dahingeschmetterte Lied auslöst: Shitstorm, Sondersendung, Service-Public im Fadenkreuz, Pranger für die Klimastreikbewegung, verbales Zündeln. User in sozialen Netzwerken wollen Köpfe rollen sehen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einstellen, und die Spitze des Westdeutschen Rundfunks (WDR) in Köln nimmt den Song sofort aus dem Netz und gibt sich devot. Politiker diverser Parteien (und nicht nur in Deutschland) ziehen Vergleiche zu Diktatur und DDR-Praktiken, Rechtsextreme nutzen das Lied als Steilvorlage für eigene Interessen und marschieren vor dem WDR-Funkhaus in Köln auf. Die Massivität der Empörung und die Art der Reaktionen offenbaren Abgründe.
Anlass zum Generationendialog
Doch so wie Gewitter oft drückende Wetterlagen wegblasen, kann auch der Oma-Song-Sturm manches klären. Er macht wie bereits die „How dare you“-Rede von Greta Thunberg auf dem UN-Klimagipfel im September in New York eine Kluft deutlich sichtbar: hier die jüngere Generation, die sich um ihre Zukunft sorgt und sich international in Bewegungen wie „Fridays for Future“ und „Extinction Rebellion“ verband, dort jene der älteren Generation, die Mühe haben, die Herausforderungen, die die Erderwärmung an uns alle und an unser Handeln stellt, zu akzeptieren. Eine Kluft, die beide Seiten zur kritischen Auseinandersetzung nicht nebeneinander, sondern miteinander zwingen sollte.
Schuldzuweisungen vor allem von Jüngeren an die Älteren sind nicht selten, wenn sich Generationen aneinander reiben – man erinnere sich an die teilweise ungerechten Vorwürfe der 68er an ihre Eltern, dass sie den Nationalsozialismus nicht einfach verhinderten. Wichtig ist, wie man damit umgeht.
Nicht alles ist schlecht an den Alten
Satire überspitzt die Wirklichkeit, die in den Songstrophen vorgetragene Kritik trifft zu: Viele der Besungenen steigen tatsächlich in einen SUV, essen viel Fleisch, machen Kreuzfahrten, leben weiterhin nach der Devise „nach mir die Sintflut“. Und der Anteil jener, die es gewohnt sind, relativ sorglos die Umwelt zu benutzen, und die mit dem Umdenken ihre Mühe haben, ist unter den Älteren höher als mittlerweile unter den Jüngeren. Aber ebenso stimmt: Etliche der Besungenen gehören einer Generation an, die die ökologische Bewegung groß machte, sodass mittlerweile Umweltthemen in viele Parteiprogramme eingeflossen sind, umweltfreundlich gebaut wird und Elektroantriebe sowie regenerative Energien eingesetzt werden.
Diese Großelterngeneration der Nachkriegsjahrgänge schuf eine verglichen mit der eigenen Kindheits- und Jugendzeit für ihre Enkel wesentlich bequemere Welt, in der sich diese ihr eigenes Leben mit technischen Hilfsmitteln wie Smartphones et cetera, die in der Öko-Bilanz ebenso auf der Negativseite zu Buche schlagen, einrichten. Unterm Strich muss sich jeder auch an die eigene Nase fassen, sowohl die jüngere als auch die ältere Generation haben Grund und die Verpflichtung, miteinander über Verantwortung und Normen in der heutigen und künftigen Gesellschaft zu reden.
All diese Fragen in Sachen Einstellung bezüglich den laut der Klimaforschung uns alle massiv betreffenden Risiken verschwinden derzeit im Nebel der Entrüstungsgefechte rund um ein albernes Lied.
Schwarmintelligenz, Schwarmempörung
Die Menge, der Schwarm, kann auch intelligent sein. Sein Leistungspotenzial wurde schon verglichen mit der Art, wie sich Ameisen oder Zugvögel koordinieren. Ähnlich können sich durch Digitalität zum Beispiel auch politische Protestbewegungen vernetzen und koordinieren, wie dies zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung belegt. Um zu verstehen, warum die Schwarmwirkung gerade aber negativ ausfällt, nützt ein Blick in zwei Schriften: Der Philosoph Byung-Chul Han („Im Schwarm. Ansichten des Digitalen“) bezieht sich auf die Gesellschaft im Ganzen, der Journalist Arno Frank („Meute mit Meinung. Über die Schwarmdummheit“) auf Journalismus und sein Publikum. Es müsse mündiger werde, ihm sei eine Rückkehr zu elementaren Umgangsformen abzuverlangen und beiden Seiten ein wirklicher Dialog; bislang führten Publikumsinteraktionen häufig bloß zu „Besserwisserei, Beleidigungen und Bedrohungen“ (Frank).
Oder zu „sofortiger Affektabfuhr“ (Han). Empörungswellen seien sehr „effizient, um Aufmerksamkeit zu mobilisieren und zu bündeln“, aber viel zu unberechenbar und unkontrollierbar, um den öffentlichen Raum und Diskurs zu gestalten. „Die Empörungswellen entstehen oft angesichts jener Ereignisse, die eine sehr geringe gesellschaftliche oder politische Relevanz haben.“ Han setzt die „Empörungsgesellschaft“ mit einer „Skandalgesellschaft“ gleich, die nicht die Sorge um Gesamtgesellschaftliches und Gemeinschaft umtreibe, sondern letztlich die Sorge der Einzelnen um sich selbst. Weil und solange es an Haltung oder an einem Sinn fürs Gemeinsame fehle, seien sachliche Kommunikation, Dialog und Diskurs im öffentlichen Raum nicht möglich.
Der Oma-Song ist ein solches im Kern wenig wichtiges „Ereignis“. Es wird instrumentalisiert, um Aufmerksamkeit zu bündeln und Empörung zu schüren – gegen öffentlich-rechtliche Medien und vieles mehr, was demokratische Gesellschaften ausmacht, und gegen jene, die sich Sorgen wegen des Klimawandels machen.
Büßergewand statt Rückgrat und Einordnung
Informationsjournalismus müsste genau solche Zusammenhänge zeigen und analysieren. Erst recht öffentlich-rechtliche Sender, deren Leistungsauftrag lautet, einzuordnen und ein Forum für den Diskurs über für eine Gesellschaft wichtige Fragen zu schaffen. Stattdessen zeigt offenbar die fortwährende Kritik daran Wirkung, erzeugt Verunsicherung, Schweigen, und statt Kontext und Haltung zu vermitteln, geht man in die Knie. WDR-Intendant Tom Buhrow streifte sich sofort ein Büßergewand über, statt einfach die Aufgabe von Public Service in einer demokratischen Gesellschaft zu erläutern und darzulegen, was Satire und Meinungsäußerung ausmacht. „Es war ein Fehler, ich entschuldige mich ohne Wenn und Aber dafür“, erklärte Buhrow in einer wegen des Kinderchor-Videos eigens anberaumten Sondersendung. Das Video hatte der Sender gleich nach den ersten kritischen Stimmen aus dem Netz, genommen. Die Deutsche Umwelthilfe und das Kinderhilfswerk kritisierten diese Reaktion als überzogen. Und wahrscheinlich ermuntert sie die „Empörten“ sogar noch, ihren Druck auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter zu erhöhen.
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) befand, der WDR habe mit dem Lied „die Grenzen des Respekts gegenüber Älteren überschritten“, und unterstellt die Absicht zu „spalten“ und zu „tribunalisieren“. Die FPÖ nutzte den Eklat in Deutschland, um den ORF ins Visier zu nehmen. FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär Christian Hafenecker verlangte vom ORF, nicht länger zu schweigen, sondern lauthals den WDR zu kritisieren und mit Sanktionen zu belegen dafür, dass er mit diesem Lied „Generationsverhetzung“ betreibe; in Deutschland wie in Österreich sei der öffentlich-rechtliche Rundfunk „ultralinks unterwandert“ und verfolge „das Ziel, das Bürgertum zu spalten und linke Utopien gesellschaftsfähig zu machen“. FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer bezeichnete es als „schäbig“, Kinder für politische Zwecke zu instrumentalisieren, und tat dies mit einer Anspielung auf Thunbergs Frisur im selben Atemzug selber: mit der „Zöpferldiktatur“ müsse nun Schluss sein und damit, dass Kinder regelmäßig während der Schulzeit mit Genehmigung der Schulleitungen demonstrieren gehen.
Entpolitisierung eines Sachproblems
Wirklich Schluss sein müsste endlich mit der Politisierung eines ernsthaften Sachproblems: Erderwärmung betrifft partei- und grenzübergreifend jeden, egal welchem politischen Lager er sich sonst zugehörig fühlt. Die Politik hat vielmehr den Auftrag, Konzepte zu entwickeln, wie man diesem Sachproblem begegnen kann. Und Journalismus muss den vielstimmigen öffentlichen Diskurs darüber ermöglichen, wie wir uns als Gesellschaft dem gegenüber verhalten wollen – ein in einer digitalen Gesellschaft schwerer als zuvor erfüllbarer Auftrag. Denn die digitale Technik bewirkt, dass Regeln und Räume sich auflösen und sich Ansichten über sich schnell ausbreitende Shitstorms und Hassreden vermehren, die eine vernünftige Debatte und Reflexion unter sich begraben.
Bislang gibt es noch zu wenig Zutritts- und Verhaltensregeln, die schlechtes Benehmen und Hassreden eindämmen. Wenn User in sozialen Medien einem WDR-Journalisten wegen eines missglückten Vergleichs (Omas und Nazis) mit Gewalt und Mord drohen, würde man sich einen Sturm der Empörung aus Gesellschaft und Politik wünschen, der sie ins Abseits stellt und ihnen klarmacht, dass solche Hasskommentare nichts mit Meinungsäußerungsfreiheit zu tun haben. Und wenngleich „Umweltsau“ kein Beispiel für sprachliche Sorgfalt ist, so entbehrt die Wucht der Empörung darüber der Verhältnismäßigkeit. Und dies nicht bloß wegen eines Urteils des Berliner Landgerichts bezogen auf eine Politikerin im September 2019, wonach Beschimpfungen wie „Drecks Fotze“ und „Stück Scheisse“ die Person nicht diffamierten und damit keine Beleidigungen seien.
Die Aufklärung im 18. Jahrhundert prägt bis heute unser Verständnis von Öffentlichkeit. Die Forderung nach Öffentlichkeit knüpft an die Norm der Meinungs- und Pressefreiheit an und richtete sich gegen staatliche Zensur, also dagegen, dass die Obrigkeit für sie unbequeme, aber für die Gesellschaft wichtige Informationen absichtlich zurückhält. Öffentlichkeit soll, so Immanuel Kant (1724–1804) in seiner Abhandlung „Was ist Aufklärung“, den Rahmen schaffen, in dem die Menschen selber denken, einander aufklären und von ihrer Vernunft Gebrauch machen. Jürgen Habermas knüpft daran in seiner Diskurstheorie an. Er definierte in seiner Schrift „Faktizität und Geltung“ (1992) Öffentlichkeit als ein „Netzwerk für die Kommunikation von Inhalten und Stellungnahmen“, aus dem sich „öffentliche Meinungen“ entwickeln.
Public Service als Prinzip soll sicherstellen, dass dies wirklich geschieht. Öffentlich-rechtliche Medien müssen diesen Auftrag erfüllen, private können dies tun. Solcher Informationsjournalismus sichert in einer demokratischen Gesellschaft den Zugang zu den Informationen, die nötig sind, um als Bürgerin oder Bürger gut informiert wählen und mitdiskutieren zu können. Aber es ist Sache des Einzelnen, ob er diesen Zugang nutzt. Gebührengelder sind eine Variante, um den Informationszugang zu finanzieren und damit letztlich Solidarabgaben für die Demokratie. Unabhängige, kritische Medien und das Public-Service-Prinzip sichern den Bestand einer Demokratie. Das steht außer Frage. Durchaus infrage zu stellen ist, ob Medienunternehmen ihre Aufgabe gut erfüllen.
Der WDR-Song war sicher keine Sternstunde. Ihn zum Anlass zu nehmen, gegen den Strom der überschäumenden Entrüstung zu schwimmen, macht die Sicht frei auf wirklich drängende Probleme.
Erstveröffentlichung: derstandard.at vom 9. Januar 2020
Bildquelle: pixabay.de
- 13Shares
- Facebook13
- Buffer
Schlagwörter:"Umweltsau", Fridays for Future, Greta Thunberg, Klimawandel, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Oma-Song, Public Service, Satire, Shitstorm, Tom Buhrow, WDR