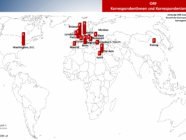Beim Spiegel in Hamburg streiten sie wieder mal. Das ist nichts Neues. Besonders reizvoll ist diesmal nur, dass sich die beiden Chefredakteure des Blatts bekämpfen.
Grund für den Streit ist die Online-Strategie. Der eine Chef, Georg Mascolo, ist für die Druckausgabe zuständig. Er will, dass künftig auch für Spiegel online bezahlt werden muss. Der andere Chef, Mathias Müller von Blumencron, ist für die digitale Ausgabe zuständig. Er will, dass Spiegel online gratis bleibt.
Der Konflikt ist darum interessant, weil er die Frontlinie der ganzen Medienbranche widerspiegelt. Es gibt die Freibier-Fraktion, die Internetinhalte für Nutzer unentgeltlich anbietet und sich nur über Werbung refinanzieren will. Es gibt den Bezahl-Block, der Internetinhalte gegen Geld liefert und dafür weniger Kunden und weniger Werbung in Kauf nimmt.
Beim Spiegel lösten sie den Konflikt zwischenzeitlich so, dass sie sich einfach von beiden Chefredakteuren trennten. Das hat den Vorteil, dass zumindest einer der beiden Entlassenen unrecht hat. Man weiß nur nicht, welcher.
Wenn man die neusten Marktbewegungen betrachtet, dann wäre beim Spiegel der Online-Chefredakteur der falsche Mann. In der Medienindustrie hat sich in den letzten drei Wochen so etwas wie ein Dammbruch ereignet.
Eine ganze Reihe von führenden Blättern hat soeben angekündigt, nun eine Bezahlschranke, eine Paywall, für ihre Online-Inhalte zu errichten. Das Ende der bisherigen Gratiskultur verkündeten fast gleichzeitig etwa die Washington Post, der Daily Telegraph, die Sun und die Los Angeles Times.
Allesamt setzen sie auf das sogenannte metered model, das von der Financial Times erfunden wurde und sich international durchgesetzt hat. Die ersten paar digitalen Abrufe – zum Beispiel zwanzig Artikel pro Monat – sind gratis. Dann aber muss bezahlt oder abonniert werden.
Auch in der Schweiz brach zugleich die letzte Bastion der Freibier-Fraktion zusammen. Der Tages-Anzeiger, die größte Abo-Zeitung des Landes, will noch in diesem Jahr auf bezahlte Online-Inhalte umschwenken. Lange war das Blatt das berüchtigte Widerstandsnest der Gratis-Aktivisten. Nun folgt es der NZZ, die den Schritt zum Cash-Modell schon im vergangenen Jahr vollzog.
Der Grund für die aktuelle Massenbewegung zum paid content liegt nicht darin, dass die Medienbranche schon immer zu Massenhysterien neigte. Der Grund liegt primär in New York.
Als die New York Times zuletzt ihren Jahresabschluss bekanntgab, war es ein Zeichen der Zuversicht. Der Gewinn lag bei 133 Millionen Dollar, während man 2011 noch arge Verluste geschrieben hatte. Ein entscheidender Faktor war dabei der Erfolg im digitalen Markt. Die New York Times hat inzwischen schon 650 000 Abonnenten ihrer Online-Ausgabe. Mit Druckerschwärze gehen daneben noch eine Million Exemplare von der Rolle. Die Branche sah, dass es also geht im Netz, wenn man es richtig macht.
Nun sind die Leser aber nicht blöd. Sie wissen genau, dass eine Zeitung, die durch die Luft zu ihnen kommt, viel billiger sein muss als ein Blatt, das physisch gedruckt und in ihren Briefkasten verteilt wird. Sie wollen also Rabatt, und zwar nicht zu knapp.
Bei manchen Zeitungen bekommen Leser inzwischen fünfzig Prozent Rabatt, wenn sie nur die digitale Ausgabe beziehen. Andere Zeitungen bieten noch mehr Discount, damit die Nutzer ihre Paywall überwinden.
Ein bisschen Ironie zum Schluss: Wir können also davon ausgehen, dass die Leser irgendwann hundert Prozent Rabatt für ihre elektronische Zeitung wollen. Dann sind wir ungefähr so weit wie zuvor.
Erstveröffentlichung: Die Weltwoche vom 10. April 2013
Bildquelle: masahiko/ Flickr
Schlagwörter:Bezahlschranke, Financial Times, Georg Mascolo, Gratiskultur, Mathias Müller von Blumencron, metered model, New York Times, NZZ, Online-Strategie, Paywall, Schweiz, Spiegel, Spiegel online, Tages-Anzeiger