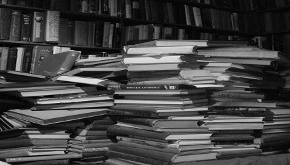CC-BY-SA 2.0 Tanja Cappell
Vor der Bundestagswahl spielt Social Media eine große Rolle. Sein Einfluss ist gefürchtet. Doch Studien zeigen: Auch das Nutzerverhalten ist oft problematisch. Das hat Auswirkungen auf den Journalismus.
Social Media hat das Nachrichtenwesen revolutioniert – und dabei die politische Bildung auf gefährliche Abwege geführt. Besonders deutlich wird dies in Wahlkämpfen, wenn Plattformen wie X, ehemals Twitter, politische Echokammern verstärken, Desinformationskampagnen Raum geben und Algorithmen extremistische Inhalte bevorzugen. Statt Verantwortung zu übernehmen und Inhalte zu regulieren, rechtfertigen Tech-Giganten ihre Untätigkeit oft mit dem Schutz der Meinungsfreiheit. Elon Musk treibt diese Dynamiken als CEO von X und Trump-Berater auf die Spitze: Er hofiert international extrem rechte Parteien und wirbt offen für die AfD. Sein Einfluss, vor allem auf junge Männer, ist enorm.
Doch genau um sie, die Nutzer, geht es erstaunlich selten in der Diskussion um Social Media und ihr Einfluss auf Wahlverhalten. Sie werden meist als Opfer dargestellt, als Puppen, die gespielt und manipuliert werden. Das Problem: immer mehr Menschen nutzen Social Media als primäre Nachrichtenquelle. Ein gefährlicher Trend, wie eine 2023 veröffentlichte Studie aus dem Journal Digital Journalism zeigt. Denn Nutzer halten sich oft für informierter, als sie es sind.
Eine potenzielle Gefahr für Demokratien
Die Forscher Sangwon Lee, Edson Tandoc und Trevor Diehl haben in ihrem Paper Uninformed and Misinformed: Advancing a Theoretical Model for Social Media News Use and Political Knowledge untersucht, wie der Nachrichtenkonsum über Social Media die politische Bildung von Nutzern beeinflusst. Sie analysieren sowohl den Einfluss auf das faktische Wissen als auch die Anfälligkeit für Misinformationen.
Bereits 2017 zeigten Allcott und Gentzkow, dass Social Media eine bedeutende Rolle bei der Verbreitung von Fake News spielt. Während der US-Wahl 2016 wurde Twitter massiv von Russland genutzt, um mit gefälschten Informationen das politische Klima zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen. 42 % der geteilten Links auf Social Media führten zu Fake-News-Seiten, während seriöse Nachrichtenquellen nur 10 % der Verlinkungen ausmachten. Diese Erkenntnisse verdeutlichen, warum Experten Social Media als Gefahr für die Demokratie einstufen.
Im US-Wahlkampf 2020 führten Lee, Tandoc und Diehl zwei Umfragen mit 752 Teilnehmern durch – eine vor der Wahl und eine danach. Um ein repräsentatives Ergebnis zu gewährleisten, verwendeten sie Stratified Quota Sampling. Dieses Verfahren stellt sicher, dass wichtige Merkmale wie Alter, Einkommen, Geschlecht oder Herkunft in der Stichprobe proportional abgebildet werden.
Gefährlicher Irrglaube, alles Relevante schon mitzubekommen
Die Analyse der Daten zeigt: Je mehr Menschen Social Media nutzen, desto geringer ist ihr faktisches Politikwissen und desto anfälliger sind sie für Misinformation. Doch welche kognitiven Mechanismen liegen diesen Zusammenhängen zugrunde? Lee, Tandoc und Diehl untersuchten insbesondere zwei Konzepte: die News-Find-Me-Perception und Information Overload. Die News-Find-Me-Perception beschreibt das Gefühl, dass es nicht notwendig ist, aktiv Nachrichten zu verfolgen, da alles Wichtige ohnehin über soziale Netzwerke erreichbar sei. Nutzer verlassen sich dabei auf ihre Filterblase und verzichten zunehmend darauf, primäre Nachrichtenquellen eigenständig zu nutzen. Dies führt zu einer gefährlichen Passivität im Umgang mit Informationen.
Daniel Kahnemann erklärt in „Schnelles Denken, langsames Denken“, dass unser Gehirn Informationen vereinfacht, um sie schneller zu verarbeiten. Diese Vereinfachung beruht auf sogenannten Biases, wie dem Confirmation Bias: Menschen bevorzugen Informationen, die ihre eigenen Ansichten bestätigen, und ignorieren oder kritisieren gegensätzliche Positionen übermäßig. In sozialen Netzwerken verstärkt sich diese Tendenz: Nachrichten von vertrauenswürdigen Kontakten hinterfragen wir weniger, und je häufiger wir eine Information sehen, desto glaubwürdiger erscheint sie uns. Plattformen wie TikTok, auf denen snackable content – kurze, visuell ansprechende Inhalte – besonders erfolgreich ist, verstärken diese Dynamik. Das Problem ist, dass viele Nutzer nach diesen oberflächlichen Informationen nicht in tiefgehende Recherchen einsteigen, um komplexe Themen, wie den Nahost-Konflikt, richtig zu verstehen.
Hinzu kommt, dass viele Nutzer eher zufällig auf Nachrichten stoßen, während sie durch ihren TikTok- oder Instagram-Feed scrollen. Nachrichten werden so zu einem beiläufigen Beiwerk und bleiben oberflächlich. Die Folge ist eine Abhängigkeit von Meinungsblasen, die Meinungsvielfalt minimiert und eine kognitive Auseinandersetzung mit Informationen erschwert. Die News-Find-Me-Perception erklärt, warum sich Menschen trotz mangelnder Beschäftigung mit Nachrichten gut informiert fühlen – und es dennoch oft nicht sind.
Viel zu viele Informationen
Das unbewusste und passive Konsumieren von Nachrichten führt zu einem weiteren Problem sozialer Medien: der Überforderung durch Informationsüberflutung. Die meisten Plattformen präsentieren den Nutzern einen unstrukturierten Mix aus seriösen Nachrichten, Misinformation, Desinformation, persönlichen Inhalten und Memes. In den frühen Tagen der sozialen Medien hofften Forschende, dass diese Vielfalt zu einem positiveren Informationsfluss beitragen würde – eine Erwartung, die sich nicht erfüllt hat.
Gerade Nutzer, die sich durch die Masse an Informationen überfordert fühlen, verlassen sich verstärkt auf ihr soziales Netzwerk, um Informationen zu filtern. „Diejenigen, die nicht in der Lage sind, endlose Informationsströme zu verarbeiten, […] würden sich auf andere in ihren sozialen Netzwerken verlassen, um die Nachrichteninformationen zu bündeln“, schreiben Lee, Edson und Diehl.
Es kommt zum Information Overload. Nutzer fühlen sich überfordert mit der Menge an Informationen. Das wirkt hierbei als Verstärker der News-Find-Me-Perception: Der ständige Reiz durch unzählige Inhalte führt dazu, dass Nutzer Verantwortung abgeben und Nachrichten oberflächlicher konsumieren. Dies macht sie anfälliger für falsche Informationen, da sie auf die Verlässlichkeit ihrer Netzwerke vertrauen. Die Forschung zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, die Media Literacy zu stärken – die Fähigkeit, Informationen kritisch zu bewerten und selbstständig einzuordnen. Initiativen zur Förderung von Medienkompetenz könnten helfen, Nutzer besser auf die Herausforderungen des digitalen Informationszeitalters vorzubereiten.
Der Journalismus muss sich verändern
Der Journalismus steht vor der Herausforderung, in einer Aufmerksamkeitsökonomie zu bestehen, ohne dabei das Vertrauen des Publikums zu verlieren. Laut Verhaltensforscher Jerome Bruner bleiben Geschichten bis zu 22-mal besser im Gedächtnis als pure Fakten. Narrative Formate bieten daher die Chance, Fakten nicht nur zu vermitteln, sondern sie durch emotionale und visuelle Elemente nachhaltig zu verankern. Besonders Datenjournalismus, der große Informationsmengen in anschauliche Geschichten übersetzt, ist ein vielversprechender Ansatz, um die Reichweite in sozialen Netzwerken zu erhöhen, schlussfolgern Lee, Edson und Diehl.
Doch der Schlüssel liegt nicht nur in der Aufmerksamkeit, sondern im Vertrauen. Die Investigativjournalistin Julia Angwin sieht hier Potenzial: Journalist:innen können von Content Creators lernen, die auf Plattformen wie TikTok oder Instagram erfolgreich sind. Transparenz, aktive Kommunikation und Nähe zum Publikum stärken die Glaubwürdigkeit. Ebenso wie Social-Media-Schaffende sich mühsam das Vertrauen ihres Publikums erarbeiten, sollten Journalist:innen dies nicht als selbstverständlich ansehen.
Angwin fordert, dass diese stärker in den Dialog mit ihrem Publikum treten. Geschichten sollten transparenter die Rechercheprozesse darstellen und das Publikum auf eine Entdeckungsreise mitnehmen. Es geht darum, nicht nur über Menschen zu berichten, sondern mit ihnen zu sprechen – ob bei Themen wie Einwanderung oder Kriminalität. Journalist:innen müssen mit den Subjekten sprechen, über die sie schreiben und etwa bei Kriminalfällen genauso viel Zeit aufwenden, um mit Opfern und Tätern zu sprechen, wie sie mit der Polizei sprechen – wenn nicht sogar mehr.
Interaktion mit der Community für mehr Vertrauen
Weiterhin fordert die ehemalige Reporterin der renommierten Investigativ-Stiftung ProPublica, dass mehr Ressourcen für Community-Management bereitgestellt werden müssen. Medien müssen in die direkte Interaktion gehen, um Nahbarkeit zu schaffen. Die New York Times ist wie so oft Vorreiterin. Hier wählen Moderatoren qualitativ besonders wertvolle Kommentare aus, die in der eigenen Kommentarsektion hervorgehoben werden. So werden konstruktive Diskussionen gefördert und ein Anreiz geboten, sich an solchen zu beteiligen. Bei ABC Australia gibt es mit dem Innovation Lab eine ganze Abteilung, die sich damit auseinandersetzt, wie die Beziehung zu den Zuschauern vertieft werden kann.
Auch in Deutschland gibt es schon entsprechende Ansätze. Ein Beispiel, wie dies gelingen kann, ist der Spiegel, der mit Artikeln zur „Geschichte hinter der Geschichte“ Einblicke in journalistische Arbeit gibt. Doch anstatt dies nachträglich zu erläutern, könnte es effektiver sein, diese Transparenz direkt in die Storys zu integrieren. Wer Medien gegenüber misstrauisch eingestellt ist, wartet nicht auf die Erläuterung der Recherche. Im Gegensatz zur NYT etwa wird die Community auch nicht aktiv eingebunden, sie bleibt nur Konsument.
Die Zukunft des Journalismus liegt darin, die Mechanismen sozialer Medien nicht nur zu verstehen, sondern sie aktiv zu nutzen, um vertrauenswürdige Inhalte zu verbreiten. Mit stärkeren Narrativen, Community-orientierter Arbeit und einer konsequenten Transparenz können Journalist:innen das Vertrauen ihrer Leser zurückgewinnen und die Demokratie stärken. Denn nur in einer funktionierenden Demokratie kann auch wirklich unabhängiger Journalismus stattfinden.
Schlagwörter:Confirmation Bias, Demokratie, Filterblase, Social Media, Wahlen