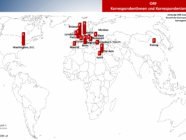Dieses Bild wurde mithilfe von ChatGPT erstellt.
„Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst“, soll der amerikanische Gouverneur Hiram Johnson 1914 gesagt haben. Gemeint war die Anfälligkeit von Berichterstattung für Nationalismus, Falschbehauptungen und Gewaltverherrlichung in Kriegszeiten. Abgesehen davon, dass in Kriegen immer zuerst Menschen sterben (Löffelholz, 2024), stellte Johnson früh etwas fest, was später Bestandteil eines ganzen journalistischen Forschungszweigs wurde.
Wie wird in deutschen Nachrichtensendungen über den Ukrainekrieg berichtet? Wer kommt zu Wort, wer gilt als Expert:in? Wird ausgewogen oder einer Kriegspartei gegenüber besonders wohlgesonnen berichtet? Werden Waffenlieferungen, Diplomatie oder doch Sanktionen gegen Russland vorrangig besprochen? Und wie viel Raum wird dem Frieden, wird der Zukunft und dem jahrzehntelangen Konfliktkontext eingeräumt? All diese Fragen sind Teilaspekte einer konfliktsensitiven Berichterstattung.
Diesen Teilaspekten und der übergeordneten Frage, wie konfliktsensitiv in Liveschalten des heute journals und der tagesthemen über den Ukrainekrieg berichtet wird, habe ich mich in meiner Bachelorarbeit gewidmet. Handbücher und wissenschaftliche Aufsätze darüber, wie Friedensjournalismus aussehen soll, gibt es viele, aber zu messen, ob diese Tipps und Kriterien in der Berichterstattung, bewusst oder unbewusst, befolgt werden, ist eine Herausforderung. Denn jeder Krieg, Konflikt und die daraus resultierende Konstellation an (internationalen) Parteien, Bündnissen, Narrativen und (militärischen) Feldzügen ist anders. Deshalb war meine Studie in vielerlei Hinsicht eine Pilotstudie und ein Vorschlag, welche Kriterien aus der Forschung sich auf die Berichterstattung über den Ukrainekrieg anwenden lassen – und welche nicht.
Theoretische Herleitung: Die Entwicklung eines Friedensjournalismus
Friedensjournalismus hat seine Wurzeln in der kritischen Auseinandersetzung mit traditioneller Kriegsberichterstattung. In den 1960er Jahren kritisierten die norwegischen Friedensforschenden Johan Galtung und Mari Ruge klassische Nachrichtenfaktoren und legten damit die Grundlagen für ein alternatives Konzept. In der Kriegsberichterstattung solle sich nicht nur auf militärische Auseinandersetzungen konzentriert werden, sondern auch die strukturellen Ursachen von Konflikten sowie mögliche friedliche Lösungen beleuchtet werden. In Galtungs späteren Ausarbeitungen gab er Medien sogar die Aufgabe, nicht nur über Gewalt zu berichten, sondern auch aktiv dazu beizutragen, Eskalationen zu verhindern und Friedensprozesse zu fördern. Die ersten deutschen Forschungen, etwa von Wilhelm Kempf und Nadine Bilke, griffen diese Ideen auf und entwickelten sie weiter, indem sie Konzepte wie Multiperspektivität, Konfliktsensitivität und eine differenzierte Ursachenanalyse stärker in den Fokus rückten. In der Vergangenheit tendierten zum Beispiel US-Medien dazu, parteiisch zu sein. Die amerikanische Berichterstattung über den Irakkrieg ist dafür ein Beispiel. Und auch nach dem 11. September 2011 etablierte sich eine patriotische Lesart der Ereignisse, die wenig Spielraum für andere Interpretationen, als die von Präsident George W. Busch zuließ (Bilke, 2005). Es ist davon auszugehen, dass auch in Deutschland nationale Phänomene in der Berichterstattung auftauchen. Trotz auch deutscher Forschung zum konfliktsensitiven Journalismus, ist nicht davon auszugehen, dass die Konzepte des FJ unter Journalist*innen bekannt genug sind, als dass sie es in den Redaktionsalltag geschafft haben(Rottmann, 2022).
Der Ukrainekrieg: eine friedensjournalistische Pilotstudie
Die Anwendung, zum Beispiel des Konzepts der konfliktsensitiven Berichterstattung von Bilke, auf den Ukrainekrieg stellt eine besondere Herausforderung dar. Deutschlands Rolle im Ukrainekrieg ist die einer Konfliktpartei, nicht aber einer Kriegspartei, weshalb sich einige Kriterien nicht oder nur abgewandelt anwenden ließen. Zudem wird im Ukrainekrieg auch ein Kampf zwischen Demokratie und Autokratie ausgehandelt, was eine besondere Sorgfalt beim Finden einer friedensjournalistischen Perspektive erfordert. Die Forderung nach gleichberechtigter Perspektivenvielfalt kann in diesem Kontext problematisch erscheinen, da sie die Gefahr einer “False Balance” birgt, also der irreführenden Gleichsetzung von Aggressor und Verteidiger (Maurer, 2024). Hier gilt der kritische Objektivitätsbegriff, also dass die Berichterstattung „die zu berichtenden Sachverhalte so richtig, vollständig und präzise wie möglich darstellt“ (Bilke, 2005). Auch Bilkes Ansatz, Konfliktsensibilität mit menschenrechtsgeleiteter Berichterstattung zu verknüpfen (Bilke, 2008), stößt hier an Grenzen: Wie kann man vermeiden, Konfliktparteien in „Gut“ und „Böse“, beziehungsweise in „Aggressor“ und „Opfer“ einzuteilen, wie von Bilke gefordert, und objektiv über Friedenslösungen sprechen, wenn eine Konfliktpartei – in diesem Fall Russland – nicht nur das Opfer, die Ukraine, völkerrechtswidrig angegriffen hat, sondern auch Friedensverhandlungen ablehnt oder gezielt untergräbt? Bestimmt keine unlösbaren Fragen für den Friedensjournalismus, nur hatte sie bislang kaum einer in der Forschung gefragt.
Wie wird der Ukrainekrieg in den tagesthemen und dem heute journal behandelt?
Für meine eigene Analyse habe ich mir die beiden großen Nachrichtensendungen tagesthemen (ARD) und heute journal (ZDF) angeschaut. Der Untersuchungszeitraum beschränkt sich auf die Woche rund um den Angriff Russlands 2022 und auf die gleichen Zeiträume in den beiden Folgejahren.
2023: 17.02-16.03.
2024: 21.02.-27.02.
Tt: für alle Jahre 21.02.-27.02.
Die unterschiedlichen Zeiträume ergeben sich aus der schlechten Abrufbarkeit der ZDF-Sendungen
Ausgewertet wurden ausschließlich die Liveschalten mit Expert:innen, Politiker:innen und Korrespondent:innen der jeweiligen Sender. Insgesamt wurden 62 Liveschalten ausgewertet, davon 52 dezidiert inhaltlich.
Konkrete und hier vereinfachte Forschungsfragen waren zum Beispiel: Kommen häufiger Vertreter:innen der nationalen Eliten zu Wort (Politiker:innen, Militärs) oder unmittelbar vom Krieg Betroffene und unabhängige Expert:innen (Ärzte, NGOs, Soldat:innen, Wissenschaftler:innen)? Wird Kriegsstrategie besprochen oder diplomatische Vorstöße? Werden Perspektiven einer der beiden Kriegsparteien bevorzugt? Werden auch Perspektiven des globalen Südens und russischer Verbündeter berücksichtigt? Wird der Konflikt historisch erläutert und werden Zukunftsszenarien und -perspektiven gegeben?
Hintergrund ist die wirklichkeitskonstruierende Macht von Medien auf den öffentlichen Diskurs. Eine möglichst breite Perspektivenvielfalt, die aber gleichzeitig frei von Ideologie ist, ist ein Grundpfeiler des Friedensjournalismus. Nur so kann sich das Publikum sicher sein, sich eine eigene fundierte Meinung ohne Einflussnahme bilden zu können. Überspitzt gesagt war es das Ziel, herauszufinden, ob die Nachrichtensendungen einen (möglicherweise unterbewussten) wiederkehrenden Fokus auf bestimmte Aspekte des Krieges legen, dabei Eliten bevorzugen und eventuell Gewalt und die aktuelle Eskalation vor allem beleuchten, statt ein umfassendes Bild zu zeigen, so wie es in der Kritik am Kriegsjournalismus oftmals bemängelt wird.
Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie
- Kein Fokus auf Eliten – aber auch nicht auf Expert:innen
Insgesamt kann man nicht sagen, dass die politische oder militärische Elite bevorzugt wurde. Beide Personengruppen kamen in beiden Sendungen zusammen fast gleich oft vor, mit einem kleinen Überhang ziviler Personen. Einen Unterschied konnte ich aber zwischen den tagesthemen und dem heute journal feststellen. Die ZDF-Sendung hatte doppelt so häufig Politiker:innen zu Gast wie die tagesthemen, und insgesamt viermal Militärangehörige, die tagesthemen kein Mal. Die tagesthemen setzten insgesamt überproportional häufig auf ihre eigenen Korrespondent:innen, viermal so häufig wie auf Expert:innen. Die Expert:innen-Gruppe war ähnlich wie beim heute journal klein – fünfmal gab es eine wissenschaftliche Einschätzung im heute journal, sechsmal in den tagesthemen. Die meisten Gäste waren Politikwissenschaftler:innen, einmal war die Konflikt- und Friedensforscherin Nicole Deitelhoff im heute journal zu Gast. Im Vergleich zur Gesamtgruppe (51 Gäste) sind 11 Expert:innen eher wenig.
- Das heute journal fokussiert die Ukraine
Russland und die Ukraine werden in beiden Sendungen zusammen ungefähr gleich häufig thematisiert. Die heute-journal-Sendungen fokussieren allerdings klar die Ukraine. Auffällig ist, dass in beiden Sendungen die Perspektiven weiterer Konfliktparteien, wie China oder osteuropäischer Staaten, deutlich seltener auftauchten als westliche Perspektiven.
- Diplomatie kommt ebenso häufig vor wie Waffenlieferungen
In den meisten Schalten werden Maßnahmen gegen den Angriffskrieg diskutiert und somit nicht nur aktuelles Kriegsgeschehen wiedergegeben. Diplomatie wird insgesamt sogar am häufigsten diskutiert – nicht erhoben wurde allerdings, mit welcher Konnotation, ob also einer diplomatischen Lösung des Kriegs realistische Chancen eingeräumt werden oder nicht und welches diskursive Gesamtbild sich daraus ergibt. Das heute journal thematisiert an zweiter Stelle Waffenlieferungen, die tagesthemen Sanktionen.
- Russland als klarer Aggressor
Wenig unerwartet wird Russland als Aggressor und Angreifer klar negativ bewertet. Insgesamt fällt aber auf, dass das heute journal häufiger wertet, vor allem die Ukraine wird häufiger positiv als neutral dargestellt, während die tagesthemen insgesamt vor allem neutral über beide Parteien berichten.
Die Einteilung in Werteurteile erfolgte aufgrund von klaren Abwertungen, Benennung von Kriegsschuld (negative Wertung) oder, im Fall der Ukraine, durch Appelle an den Westen, die Ukraine zu unterstützen (positive Bewertung). Anerkennung gegenüber Russland für einen gelungenen Feldzug ist das einzige festgestellte Beispiel für eine Positivnennung im Zusammenhang mit Russland.
- Keine kreativen Lösungsstrategien in petto
Ein besonders interessanter Punkt: Friedensinitiativen oder alternative Konfliktlösungsansätze, zum Beispiel von Vereinen vor Ort oder Thinktanks spielten kaum eine Rolle in den untersuchten Sendungen. Die Berichterstattung konzentrierte sich auf die von der Politik diskutierten Maßnahmen (Waffenlieferungen, militärische Taktiken und politische Sanktionen) und bot darüber hinaus wenig weitere Vorschläge oder Perspektiven.
- Mehr Tagesaktuelles als Zukunftsaussichten
Die Zukunft vorauszusagen ist unmöglich, doch zur konfliktsensitiven Berichterstattung gehört eine Einordnung in das „große Ganze“ und ein Blick über den Tellerrand hinaus. Werden (geopolitische) Zukunftsperspektiven im Umgang mit Russland, auch nach Ende des Krieges, und/oder Ansätze, den Frieden in Zukunft besser zu sichern, diskutiert? Oder bleibt die Berichterstattung im Hier und Jetzt stehen und fokussiert vor allem tagesaktuelle Ereignisse und Kampfhandlungen? Insgesamt wird in den untersuchten Schalten mehr über Tagesaktuelles berichtet.
- tagesthemen thematisieren weniger Konfliktkontext
Rechnet man beide Sendungen zusammen, wird gleich häufig über den Konfliktkontext im weitesten Sinne gesprochen, wie nicht darüber gesprochen wird. Nach Format differenziert, wird jedoch in über der Hälfte der heute journal-Schalten über (historischen) Kontext gesprochen (15 ja/11 nein), in den tagesthemen weniger (14 ja/17nein).
Weitere Erkenntnisse
Ein zentrales Ergebnis: Die Anzahl der Interviewschalten zum Ukrainekrieg hat sich über die Jahre verringert. Während kurz nach dem Kriegsausbruch 2022 noch sehr viele Schalten gesendet wurden, war die Anzahl ein Jahr später bereits deutlich niedriger. Dies folgt einem bekannten Muster der Kriegsberichterstattung: Anfänglich große Aufmerksamkeit, danach schwindendes Interesse.
Die deutsche Regierung wird viel kritisiert. Hier muss unterschieden werden zwischen Berichterstattung über politisches Fehlverhalten und Kritik an der Bundesregierung für ihre zögerliche Unterstützung der Ukraine, unter anderem mit Waffen. Letzteres wurde in dieser Untersuchung nicht erhoben, aber in früherer Forschung (Maurer et al (2023)) bereits festgestellt. Kritik an der Politik würde für eine kritische, vom Friedensjournalismus geforderte Berichterstattung sprechen, bei der sich die Medien in einer Krise nicht mit der nationalen Politik „verbrüdern“. Auf Basis der Analyse von Maurer und Kollegen (2023) kann spekuliert werden, dass häufig Kritik an der Bundesregierung geübt wurde, weil diese nicht schneller mehr Waffen lieferte. Das wiederum wäre eine gewaltorientierte, wenig konstruktiv-konfliktbearbeitende
Forderung und damit rein formal nicht konfliktsensibel/friedensjournalistisch. Aber auch diese Schlussfolgerung ist nicht abschließend. Sicher gibt es Standpunkte im friedensjournalistischen Diskurs, die Plädoyers für Waffenlieferungen im Kontext der Abschreckung oder Verteidigung als gerechtfertigt und rechtmäßig argumentieren.
Limitationen
Hierzu muss erwähnt werden, dass die Ergebnisse sich ausschließlich auf den Untersuchungszeitraum rund um Kriegsbeginn und die Jahrestage beschränken. Es wurden im Wesentlichen Hauptthemen der Schalten identifiziert, es wurde aber nicht auf detailliert sprachlicher Ebene analysiert, wie es frühere konfliktsensible Analysen von Berichterstattung (z.B. Wolff, 2018) gemacht haben. Außerdem können keine Aussagen über die gesamte Berichterstattung der Sender oder der analysierten Sendungen getroffen werden, da zum Beispiel die Moderationstexte und Fernsehbeiträge nicht berücksichtigt wurden. Auch könnte eine größer angelegte Studie Aufschluss über die Unterschiede zwischen der Ukraine-/Russlandberichterstattung der Privatsender und der öffentlich-rechtlichen Sender geben. Schließlich bleibt auch die subjektive Interpretation der Daten eine potenzielle Einschränkung, da die Bewertung von Konfliktsensibilität immer von theoretischen Vorannahmen und subjektiver Einschätzung geprägt ist.
Fazit
Die Untersuchung hat erste Erkenntnisse über die Konfliktsensibilität in heute journal-und tagesthemen-Schalten über den Ukrainekrieg hervorgebracht. Demnach werden die Schaltgespräche in den analysierten Nachrichtensendungen nur teilweise den Anforderungen einer konfliktsensiblen Berichterstattung gerecht.
Positiv hervorzuheben ist, dass in den Bereichen „Bewertung der Kriegsparteien“, „Konfliktkontext“ und „Zukunftsperspektiven“ ein zufriedenstellendes bis hohes Maß an Konfliktsensibilität erreicht wird. Die Kriegsparteien, insbesondere Russland und die Ukraine, werden nicht ausschließlich durch stark wertende oder voreingenommene Berichterstattung thematisiert, sondern auch neutral eingeordnet. Beide Sendungen nehmen sich zudem in vielen Fällen Zeit, über das unmittelbare Kriegsgeschehen hinaus den größeren geopolitischen Kontext sowie mögliche Zukunftsperspektiven zu erörtern. Allerdings zeigen die Ergebnisse auch klare Defizite in anderen Bereichen der Konfliktsensibilität. Besonders auffällig ist der Mangel an Perspektivenvielfalt: Zwar sind Russland und die Ukraine annähernd gleich stark vertreten, westliche Sichtweisen dominieren jedoch. Länder des Globalen Südens oder russische Verbündete, bleiben weitgehend unberücksichtigt. Das spiegelt eine einseitige Fokussierung wider und deckt sich mit früheren Studien zur Überrepräsentation westlicher Perspektiven (Barthel & Bürkner, 2019).
Auch Friedensinitiativen sind unterrepräsentiert. Zivile Bewegungen werden kaum erwähnt, militärische und politische Maßnahmen wie Waffenlieferungen oder Sanktionen stehen im Vordergrund. Dabei sind zivilgesellschaftliche Bemühungen ein zentraler Bestandteil konstruktiver Konfliktbearbeitung.
Außerdem lässt die Gästeauswahl aus friedensjournalistischer Sicht zu wünschen übrig. Während beide Sendungen in etwa gleich viele Stimmen aus der politischen Elite und der Zivilgesellschaft einladen, bleibt die Auswahl an Expert:innen insgesamt begrenzt. Besonders in Hinblick auf die thematische Gewichtung der Gäste, die Relevanz der Moderationsfragen und die Bewertung von Maßnahmen wie Waffenlieferungen und Diplomatie könnten zusätzliche Analysen wertvolle Einblicke bieten. Trotzdem konnten auch in dieser Untersuchung bereits in der Literatur beobachtete Phänomene festgestellt werden. Dazu gehört die Abnahme der Berichterstattungsintensität und ein Schwerpunkt auf sowohl ukrainischen als auch europäischen Perspektiven auf den Krieg. Überraschend ist eine relativ stabile Thematisierung der Konflikthintergründe.
Sendungsspezifisch kann festgehalten werden, dass die tagesthemen und das heute journal im Großen und Ganzen ähnlich, jedoch nicht gleich berichtet haben und dass selbst in dieser kleinen Stichprobe zu sehen ist, dass die tagesthemen gemäß ihres Formatcredos und in einer Linie mit der tagesschau vor allem neutral berichten. In den Ergebnissen zeigt sich ebenso eine wertendere Tendenz beim heute journal, die dem Format der Sendung entspricht (Mehne, 2013). Allgemein offenbaren sich sowohl konzeptuelle als auch praktische Limitationen des Friedensjournalismus. Es hat sich auch gezeigt, dass es schwierig ist, Konfliktsensitivität allgemein im Journalismus zu messen und speziell im Ukrainekrieg. Dennoch öffnen die Ergebnisse der Arbeit den Diskurs und verdeutlichen die Dringlichkeit für kriegsspezifische Kriterien für Konfliktsensibilität, die in der Forschung erst noch definiert werden müssen.
Quellen und weiterführende Literatur
Barthel, M. & Bürkner, H. (2019). Ukraine and the Big Moral Divide: What Biased Media Coverage Means to East European Borders. Geopolitics, 25(3), 633–657. https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1561437
Bilke, N. (2005). Plädoyer für eine konstruktive Konfliktberichterstattung. In T. Roithner & Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (Hrsg.), „Die Wiedergeburt Europas“. Von den Geburtswehen eines emanzipierten Europas und seinen Beziehungen zur „einsamen Supermacht“. Agenda Verlag.
Bilke, N. (2008). Qualität in der Krisen- und Kriegsberichterstattung: Ein Modell für einen konfliktsensitiven Journalismus. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Galtung, J. (1998). Friedensjournalismus: Was, Warum, Wer, Wie, Wann, Wo? In W. Kempf & I. Schmidt-Regener (Hrsg.), Krieg, Nationalismus, Rassismus und die Medien (S. 3–20). Lit. Verlag. https://search.gesis.org/publication/gesis-solis-00262270
Galtung, J. & Ruge, M. (1965). The Structure of Foreign News. Journal Of Peace Research, 2(1), 64–91. http://www.jstor.org/stable/423011
Kempf, W. (2003). Konstruktive Konfliktberichterstattung – ein sozialpsychologisches Forschungs- und Entwicklungsprogramm. In Conflict & Communication Online (Bd. 2,Nummer 2, S. 1–2) [Journal-article]. verlag irena regener berlin. https://cco.regeneronline.de/2003_2/pdf_2003_2/kempf_dt.pdf
Kempf, W. (2022a). Friedensjournalismus [Handbuch Friedenspsychologie]. In C. Cohrs, N. Knab & G. Sommer (Hrsg.), Handbuch Friedenspsychologie. Philipps-Universität
Marburg. https://archiv.ub.unimarburg. de/es/2022/0070/pdf/53_Friedensjournalismus.pdf
Löffelholz, M. (2005). Handbuch Journalismus und Medien. In S. Weischenberg, B. Pörksen & H. J. Kleinsteuber (Hrsg.), Kriegsberichterstattung (S. 181–185). UVK.
Löffelholz, M., Schleicher, K., Trippe, C. F. & Radechovsky, J. (Hrsg.). (2024). Krieg der Narrative: Russland, die Ukraine und der Westen. de Gruyter.
Maurer, M., Haßler, J. & Jost, P. (2023). Die Qualität der Medienberichterstattung über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ukraine-Analysen, 289, 4–11. https://doi.org/10.31205/ua.289.01
Mehne, J. (2013). Die Nachrichtenjournale tagesthemen und heute journal. Springer-Verlag.
Rottmann, S. (2022). Plädoyer für einen konfliktsensitiven Journalismus. Perspektive Mediation, 19(2), 97. https://doi.org/10.33196/pm202202009701
Wolff, M. A. (2018). Kriegsberichterstattung und Konfliktsensitivität: Qualitätsjournalismus zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Springer-Verlag.
Schlagwörter:ARD, Berichterstattung, Ethik, Ukraine, ZDF